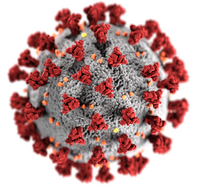SARS-CoV-2
Das Virus SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2),[4] auch als Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus Typ 2 bezeichnet, umgangssprachlich (neuartiges) Coronavirus genannt, ist ein dem SARS-Erreger ähnliches Betacoronavirus mit wahrscheinlich zoonotischem Ursprung.[5][4] Das neue Betacoronavirus wurde Anfang 2020 als Auslöser der Infektionskrankheit COVID-19 identifiziert.[4]
COVID-19 trat laut Chinas Regierung erstmals Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan als „Lungenkrankheit unbekannter Genese“ in Erscheinung.[6] Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nannte COVID-19 am 30. Januar 2020 eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“. Da die Erkrankung sich weltweit ausbreitete, wurde COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft (siehe COVID-19-Pandemie).[7][8]
Das Virus ist zwischen 60 und 140 Nanometern groß und wird in der Regel im nahen menschlichen Kontakt durch Tröpfchen und Aerosole übertragen.[9] Für die weltweite Ausbreitung spielten hierbei besonders größere Übertragungsereignisse, sogenannte Superspreading-Events, eine wichtige Rolle.[10][11] Das Virus hat mittlerweile zahlreiche Varianten (Mutationen) ausgebildet. Klinisch-diagnostische und epidemiologische Erfahrungen sprechen dafür, dass einige Varianten leichter als andere von Mensch zu Mensch übertragen werden können und möglicherweise auch schwerere Krankheitsverläufe bewirken. Die Wirksamkeit der neu entwickelten SARS-CoV-2-Impfstoffe bezüglich neuer Varianten wird momentan (Stand: Januar 2021) geprüft.[12][13]
Entdeckungsgeschichte
Im Dezember 2019 wurden in der Großstadt Wuhan gehäuft schwere Lungenentzündungen unbekannter Ursache festgestellt.[6] Am 30. Dezember 2019 informierte der chinesische Arzt Li Wenliang in einer WeChat-Gruppe seine Arztkollegen über sieben Patienten, die wegen Verdachts auf Infektion mit dem SARS-Virus im Zentralkrankenhaus Wuhan behandelt wurden;[14] dafür wurde er von der chinesischen Polizei ermahnt. Li selbst erkrankte später an COVID-19 und starb.[15]
Das Chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention entsandte am 31. Dezember 2019 ein Team in die Stadt.[16] Am selben Tag wurde das China-Büro der WHO durch die chinesischen Behörden offiziell informiert, dass im Dezember 2019 in Wuhan mehrere Personen an schwerer Lungenentzündung erkrankt waren und dass als deren Ursache ein uncharakterisierter Erreger vermutet werde. Bis zum 3. Januar 2020 wurden der WHO insgesamt 44 Erkrankte gemeldet, darunter Schwerkranke. Da mehrere Erkrankte auf dem örtlichen wet market „Südchinesischer Großhandelsmarkt für Fische und Meeresfrüchte Wuhan“ (chinesisch 武汉华南海鲜批发市场, Pinyin Wǔhàn huánán hǎixiān pīfā shìchǎng) gearbeitet hatten, wurde dort der primäre Infektionsort vermutet.[17][18] Kurz nach Auftreten der Krankheit im Dezember 2019 hatten 27 (66 %) der ersten 41 Krankenhauspatienten den Markt im Zentrum Wuhans besucht. Die Infektionen von 13 der übrigen Betroffenen hingen allerdings nicht mit diesem Ort zusammen.[19][20]
Am 7. Januar 2020 gab der die Virusidentifizierung leitende chinesische Virologe Xu Jianguo (徐建国) bekannt, der Krankheitserreger sei ein bisher unbekanntes Coronavirus. Dies hätten Untersuchungen von Blutproben und Rachenabstrichen von 15 Erkrankten ergeben. Die WHO bestätigte diese Erkenntnis am 9. Januar 2020.[21][22] Am 13. Januar 2020 wurde die komplette RNA-Genomsequenz eines Isolats des neuen Coronavirus in der NCBI-GenBank hinterlegt (GenBank-Nummer MN908947).[23] Nahezu gleichzeitig wurde ein erstes Nachweisverfahren publiziert.[24][25][26]
Eine phylogenetische Analyse der Genomsequenzen aus Umweltproben des Marktes (etwa von Oberflächen) zeigte, dass sie mit den Viren der ersten Patienten aus Wuhan sehr nahe verwandt sind.[27] Nach einer Studie des Wuhan Hospitals hatte der erste identifizierte Patient den Markt nicht besucht.[28] Keines der untersuchten Tiere vom Markt wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet, was die Annahme stützt, das Virus sei nicht dort auf den Menschen übergesprungen. Offenbar hatte sich das Virus bereits zuvor unbemerkt unter Menschen etabliert. Der Markt könnte daher Schauplatz eines frühen Superspreader-Ereignisses gewesen sein.
Aus Modellierungen aufgrund der Untersuchung der Veränderungen des Erbmaterials RNA des Virus wird als erstes Auftreten des Virus als wahrscheinlich zwischen Oktober und Anfang Dezember 2019 eingegrenzt. Die Verbreitungsmuster der verschiedenen unterscheidbaren Virusmutationen spricht für eine massenhafte weltweite Ausbreitung des Virus durch eine Vielzahl von verschiedenen Ausbreitungsereignissen.[29][30]
Als Patient null wird ein 55-jähriger Mann aus der Provinz Hubei vermutet, der sich bereits am 17. November 2019 infiziert haben könnte.[31] Nicht alle frühen COVID-19-Fälle können mit dem Markt in Verbindung gebracht werden; die Historie des Ausbruchs ist wohl komplizierter als zunächst angenommen.[27] In einer Vorab-Publikation aus dem Herbst 2020 konnte aufgrund umfangreichen Genomvergleichs eine vermutliche RNA-Sequenz der Ausgangsform („Stammvater“, en. progenitor: proCoV2) ermittelt werden, die (wie zu erwarten) vom Genom der real existierenden Referenzform etwas abweicht. Aus den Daten lässt sich ableiten, dass dieses Virus bereits einige Wochen vor den im Dezember 2019 entdeckten Erkrankungen Menschen infiziert hat. Nach Gesprӓchen mit chinesischen Medizinern schӓtzte die WHO die Anzahl der Corona-Patienten vor Dezember 2019 auf rund 1000 Personen. Zudem wurden 13 Virus-Stӓmme isoliert, die sich nicht alle dem Ausbruch in Wuhan zuordnen lassen. Es könnte sich bei 72.000 früheren Erkrankungen mit Symptomen wie Lungenentzündung, Grippe oder Fieber um SARS-CoV-2 gehandelt haben. Die Forscher lokalisieren dieses Virus und seine unmittelbaren Nachfolger in China.[32][33]
Am 10. November 2019 begab sich eine damals 25-jährige Mailänderin wegen eines Hautausschlags in ärztliche Behandlung. Anfang 2021 konnten von einem internationalen Forscherteam, koordiniert von der Universität Mailand, in der seinerzeit entnommenen Hautprobe Nukleotidsequenzen (genetische Spuren) der Ribonukleinsäure (RNA) von SARS-CoV-2 in den Schweißdrüsen nachgewiesen werden. Mit Ausnahme des unspezifischen Hautausschlags traten bei der Frau keine weiteren Symptome auf. Entsprechend einer Veröffentlichung der Wissenschaftler im British Journal of Dermatology konnten bei einem serologischen Test bei der Mailänderin noch im Juni 2020 Antikörper nachgewiesen werden.[34] Nach Aussage des Biochemikers Thomas Carell von der Universität München liefert die Kurzmitteilung in der britischen Fachzeitschrift wenig Details, „doch in einer der Abbildungen sieht man, wie sich die markierten Viren um eine entzündete Schweißdrüse verteilen“. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass es sich um eine Verunreinigung handeln könnte. Die Spuren der Viren im Hautgewebe der Mailänderin wurden mit der Methode RNA-FISH zum Leuchten gebracht, mit der auch Thomas Carell arbeitet. Um nachzuweisen, dass tatsächlich Spuren der RNA von SARS-CoV-2 markiert worden waren, brachten die Wissenschaftler anschließend ein Enzym auf die Hautprobe, worauf das Leuchten verschwand. Daraus wurde abgeleitet, dass das Enzym die Spuren des viralen Erbgutes in der Probe zerstört hatte.[35] Ob die Mailänderin nicht nur in Italien, sondern eventuell auch weltweit der „Patient null“ ist, muss jedoch noch geklärt werden.[34]
Ein noch früheres Vorkommen könnten Blutproben belegen, die im September 2019 Italienern entnommen wurden und laut einer Untersuchung im November 2020 Antikörper gegen SARS-CoV-2 enthielten.[36]
Benennung
Das Virus SARS-CoV-2 wird im allgemeinen Sprachgebrauch (nach der Virusfamilie) als „neuartiges Coronavirus“,[37] „neues Coronavirus“,[38] „Coronavirus“ oder (in deutschsprachigen Ländern) nur als „Corona“ bezeichnet.[39] Die von der WHO vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2020 verwendete Bezeichnung „2019-nCoV“ galt nach deren Aussage nur vorläufig.[40] Das National Center for Biotechnology Information (NCBI) nahm es als Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 in die Taxonomie-Datenbank auf. Das NCBI ist jedoch für Virusnamen und -klassifikationen nicht maßgebend. Das Virus wurde dort – ebenfalls vorläufig – als Wuhan seafood market pneumonia virus geführt; als Synonyme galten 2019-nCoV und Wuhan coronavirus.[41]
Die WHO griff diverse Namensvorschläge nicht auf, die gemeinsam hatten, das Virus nach dem Ort seiner Erstidentifikation als Wuhan respiratory syndrome coronavirus (WRS-CoV) zu benennen. In der Vergangenheit hatte es Beschwerden gegeben, als Viren ihren Namen nach Ländern oder Regionen erhielten.[42] (Beispiele: Marburg-Virus, MERS-CoV). Daher hatte die WHO 2015 Benennungen nach dem Entdeckungsort für unerwünscht erklärt.[43] In der NCBI-Taxonomie-Datenbank aufgeführte Synonyme waren im Februar 2020: 2019-nCoV, COVID-19, COVID-19 virus, Wuhan coronavirus und Wuhan seafood market pneumonia virus.[44][45]
Am 11. Februar 2020 gab die WHO bekannt, die durch das Virus verursachte Erkrankung als COVID-19 (oder „Covid-19“, für coronavirus disease 2019) benannt zu haben.[46][47] Am selben Tag schlug die Coronavirus Study Group (CSG) des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) auf dem Preprint-Server bioRxiv für das Virus die nun offizielle Bezeichnung SARS-CoV-2 vor (für severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).[48] Dem widersprach eine Woche später eine Gruppe chinesischer Virologen, die stattdessen „HCoV-19“ („Humanes Coronavirus 2019“) einführen wollten. Damit würde der Virusname an den von der WHO bestimmten Namen der Krankheit COVID-19 angeglichen. Außerdem bestünde die Gefahr, das Virus SARS-CoV-2 mit dem Virus SARS-CoV zu verwechseln. Sie betonten, dass sich „2019-nCoV“ von dem SARS-Virus in biologischer und epidemiologischer Hinsicht unterscheide, ebenso wie die klinischen Symptome von COVID-19 und SARS verschieden seien.[49] Zur Unterscheidung wird der Erreger von SARS auch als SARS-CoV-1 bezeichnet.[50]
Vergleichbare Diskussionen gibt es in Bezug auf die Benennung der zahlreichen SARS-CoV-2-Varianten.[51]
Merkmale
Systematik
Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist ein Vertreter der Spezies Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-assoziiertes Coronavirus, Akronym SARSr-CoV). Zu dieser Spezies gehören nur die Coronaviren SARS-CoV-2 und SARS-CoV-1. Letztere war bisher unter dem Akronym SARS-CoV bekannt und Ursache der Erkrankung SARS, während SARS-CoV-2 die COVID-19-Erkrankung auslösen kann.
Die Spezies Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus ist aktuell die einzige Spezies in der Untergattung Sarbecovirus. Der Name „Sarbecovirus“ bezieht sich auf die englische Bezeichnung SARS-like betacoronavirus (bzw. SARS-related betacoronavirus).[52][53]
Die Untergattung Sarbecovirus gehört der heutigen Gattung Betacoronavirus an. Die frühere Gattung Coronavirus wurde abgeschafft und deren Mitglieder auf die neuen Gattungen Alpha-, Beta-, Gamma- und Deltacoronavirus aufgeteilt. Zu den Beta-Coronaviren gehören u. a. auch SARS-CoV und MERS-CoV.[4]
Die Gattung Betacoronavirus gehört zur Unterfamilie der Orthocoronavirinae (früher schlicht Coronavirinae), und diese zur Familie der Coronaviridae, diese zur Unterordnung Cornidovirineae, diese zur Ordnung Nidovirales. Letztere wird noch in den virologischen Realm der RNA-Viren bzw. Riboviren (Riboviria) klassifiziert, da ihr Erbmaterial aus RNA besteht. Dadurch werden aber keine weiteren Verwandtschaftsbeziehungen im phylogenetischen Sinne ausgedrückt.
Molekulargenetik und Phylogenetik

Das Virusgenom besteht, wie in Coronaviren üblich, aus einzelsträngiger RNA (ssRNA) mit positiver Polarität. Das Isolat Wuhan-Hu-1 (NCBI-GenBank-Nummer MN908947[54]) umfasst 29.903 nt (Nukleotide) mit zwei 265 nt bzw. 229 nt langen untranslatierten Bereichen am 5′-Ende bzw. am 3′-Ende.[23] Die putativen (vermuteten) Gene könnten für zehn Proteine codieren: ein 7096 Aminosäuren (AS) langes ORF1ab-Polyprotein (Replikase-Komplex), ein 1273 AS langes S-Glykoprotein – auch als Spike-Protein bezeichnet – ein 75 AS langes Hüllprotein (E für engl. envelope, vergleiche Virushülle), ein 222 AS langes Membran-Glykoprotein (M), ein 419 AS langes Nukleokapsid-Phosphoprotein (N) und weitere fünf Proteine (ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF8 und ORF10).[23] Die Abfolge der Gene entspricht jener des SARS-Virus und der aller anderen Coronaviren.[55] Im November 2020 wurde nachträglich die Identifizierung eines „versteckten“ (überlappenden) Gens ORF3d bekannt gegeben.[56]
Mit Stand 16. Februar 2020 gab es mehr als 40 vollständige Genomanalysen von SARS-CoV-2-Isolaten. Die Genomgröße liegt zwischen 29.825 und 29.903 nt.[54] Der GC-Gehalt (der Anteil der Nukleinbasen Guanin und Cytosin) liegt bei 38,0 Mol-Prozent.[57][58] Die beiden Virusisolate HKU-SZ-002a (NCBI-GenBank-Nummer MN938384[54]) und HKU-SZ-005b (NCBI-GenBank-Nummer MN975262[54]) stammen von Patienten einer Familie aus Shenzhen und unterscheiden sich lediglich durch zwei Nukleotide. Die Genomanalyse dieser beiden Isolate ergab, dass sie nahe verwandt mit den bei Fledermäusen (englisch bat) auftretenden SARS-CoV-ähnlichen Coronaviren bat-SL-CoVZXC21 (NCBI-GenBank-Nummer MG772934) und bat-SL-CoVZC45 (NCBI-GenBank-Nummer MG772933) sind, zu letzterem besteht eine Übereinstimmung in der Nukleotidabfolge von 89 %. Das Genom der beiden Fledermaus-Coronaviren wurde 2018 sequenziert, bat-SL-CoVZC45 wurde bei der Chinesischen Hufeisennase (Rhinolophus sinicus)[59] aus der Familie der Hufeisennasen (Rhinolophidae) gefunden, die Wirtstiere wurden in Zhoushan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang in den Jahren 2015 und 2017 untersucht.[58]
Ein weiteres Virusisolat (WIV04, NCBI-GenBank-Nummer MN996528[54]) von SARS-CoV-2 aus der bronchoalveolären Spülflüssigkeit eines der ersten Patienten zeigt ebenfalls phylogenetisch größte Ähnlichkeit mit einem bei einer anderen Fledermausart (Java-Hufeisennase, wissenschaftlich Rhinolophus affinis, englisch intermediate horseshoe bat, verbreitet in Indonesien (Java), Indien, Vietnam, China)[59] in der chinesischen Provinz Yunnan isolierten Coronavirus BatCoV RaTG13; die Genomsequenzen stimmen zu 96,2 % überein.[60][50] Auch eine am 27. Januar 2020 publizierte genetische Analyse verwies auf Fledermäuse als mutmaßlicher Ursprungswirt des Virus.[61] Am 29. Januar 2020 wurde in der Fachzeitschrift The Lancet eine genetische Analyse von zehn Virusproben publiziert, die bei neun Erkrankten gewonnen worden waren. Demnach war die Genomsequenz aller zehn Proben zu 99,98 Prozent identisch, was darauf hinweist, dass die neu entdeckte Coronavirusvariante erst vor Kurzem auf den Menschen übergegangen ist.[62][63][64] Die Genomsequenz stimmt zu 88 bzw. 87 % Prozent mit den Genomsequenzen der bei Fledermäusen auftretenden bat-SL-CoVZC45 und bat-SL-CoVZXC21 überein. Die zehn Proben zeigen hingegen nur rund 79 Prozent Übereinstimmung in der Genomsequenz zu SARS-CoV und rund 50 Prozent zu MERS-CoV. Die Ergebnisse der phylogenetischen Untersuchungen werden auch als phylogenetischer Baum, der die Verwandtschaftsverhältnisse von SARS-CoV-2 innerhalb der Coronaviridae zeigt, veranschaulicht.[58][62] Eine darauf basierende Darstellung ist im Artikel Betacoronavirus zu finden.
Der Aufbau des Genoms sowohl der SARS-CoV-2-Isolate wie auch der genannten Fledermaus-Coronaviren ist typisch für Viren der Lineage B (Untergattung Sarbecovirus, englisch SARS-like Betacoronavirus) der Gattung Betacoronavirus. Aufgrund der genetischen Distanzen zu SARS-CoV und zu MERS-CoV wurde SARS-CoV-2 zunächst als eine in Bezug auf den Menschen neue, ihn infizierende Betacoronavirus-Spezies angesehen.[58][62] Aufgrund der großen genetischen Übereinstimmung mit dem ursprünglichen SARS-Coronavirus hatte am 11. Februar 2020 die Coronavirus Study Group des ICTV jedoch vorgeschlagen, das neue Virus derselben Spezies Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus zuzuordnen wie das bisherige.[48]
Das Spike-Protein ist für die Bindung an die Wirtszelle verantwortlich, funktionell wird es in die S1-Domäne und die S2-Domäne unterschieden. Die S1-Domäne vermittelt die Bindung an den Oberflächenrezeptor der Wirtszelle, die S2-Domäne vermittelt die Fusion der Zellmembran, durch Endozytose erfolgt dann der Eintritt des Virus in die Zelle. Das S-Gen von SARS-CoV-2 zeigt mit 75 % eine eher geringe Übereinstimmung in der Nukleotidsequenz mit den beiden Fledermausisolaten bat-SL-CoVZC45 und bat-SL-CoVZXC21 im Vergleich zur Genomanalyse. Insbesondere die Nukleotidsequenz, die für die S1-Domäne codiert, unterscheidet sich von diesen deutlich (68 % Übereinstimmung) und weist aber eine größere Ähnlichkeit mit der entsprechenden Nukleotidsequenz von BatCoV RaTG13 auf. Es wurde aufgezeigt, dass SARS-CoV-2 und SARS-CoV den gleichen Zellrezeptor nutzen, das Angiotensin-konvertierende Enzym 2 (ACE2).[62] Dies konnte experimentell sicher nachgewiesen werden. (vgl. Krankheitsentstehung bei COVID-19)
Beim Vergleich des Genoms von SARS-CoV-2 mit dem verwandter Fledermaus-Coronaviren zeigten sich neben der bekannten Änderung am Spike-Protein zwei weitere „stille Mutationen“ (in den Nichtstrukturproteinen NSP4 und NSP16, siehe Coronaviridae §Genom), die zwar nichts an den kodierten Proteinen, jedoch die 3D-Faltung der RNA ändern. Dies könnte dazu beitragen, dass Infizierte (anfangs) zwar ansteckend, aber (noch) symptomfrei sind.[65]
Morphologie
Coronaviren sind membranumhüllte RNA-Viren.[66] In einer Zellkultur über mehrere Tage vermehrte Viren können nach Abtrennung durch Ultrazentrifugation für die Untersuchung im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) vorbereitet werden; dabei wird eine Negativkontrastierung verwendet. Das TEM-Bild zeigt Virionen von kugelförmiger bis pleomorpher Gestalt mit einem Durchmesser von 60 bis 140 Nanometer (nm). Auf der Oberfläche sind 9 bis 12 nm lange Spikes zu erkennen. Die Morphologie entspricht der anderer bekannter Vertreter der Familie der Coronaviridae. Die Wirtszellen, die im lichtmikroskopischen Bild einen cytopathischen Effekt aufweisen, können nach Fixierung und anschließendem Ultradünnschnitt (Dicke von 80 nm) ebenfalls mit dem TEM untersucht werden. Hier zeigen sich neben Virionen auch Einschlusskörperchen, die mit Viren gefüllte membrangebundene Vesikel im Cytoplasma enthalten.[16]
Replikationszyklus
Der Replikationszyklus der Viren verläuft über mehrere Stufen:[67]
(1) Zunächst bleiben SARS-CoV-2-Virionen an speziellen Rezeptoren haften, die sich an der Oberfläche möglicher Wirtszellen befinden. Das geschieht, indem sich die Spike-Proteine der Vironen an die ACE2-Rezeptoren der Zellmembran binden. Der ACE2-Rezeptor der Wirtszellen ist deshalb ein möglicher Therapieansatz, um den Ausbruch einer COVID-19-Erkrankung nach einer Infektion mit dem Coronavirus zu verhindern.[68] Ob weitere Moleküle der Zelloberfläche das Spike-Protein binden, ist noch nicht geklärt. Im Vergleich zu SARS-CoV hat das Spike-Protein eine RGD-Peptidsequenz entwickelt, womit Rezeptoren der Integrinfamilie ebenfalls als mögliche Bindungspartner in Frage kommen.[69]
(2) Nach Bindung an den ACE2-Rezeptor spaltet die membranständige Serinprotease TMPRSS2 das virale Glykoprotein S, wodurch das Spike-Protein als fusogenes Protein aktiviert wird und der Eintritt in die Wirtszelle erfolgt. Auch TMPRSS2 ist ein potentieller Ansatzpunkt für ein wirksames Medikament.[70][71]
(3) Die Erreger werden in die Wirtszelle aufgenommen (vereinfachte Darstellung).[72]
(4) Vor Beginn der Virusvermehrung muss die Erbsubstanz (RNA) des Virus aus dem Kapsid freigesetzt werden (nur ein möglicher Weg dargestellt).
(5) Nun kann der eigentliche Vermehrungsvorgang erfolgen, die Replikation. Da SARS-CoV-2 über RNA positiver Polarität verfügt, kann die RNA direkt als „Bauanleitung“ für virusspezifische Proteine dienen, ähnlich zelleigener mRNA bei der Translation. Für die Wirtszelle ist die Virus-RNA praktisch nicht von eigener mRNA zu unterscheiden und der Proteinsyntheseapparat (Ribosomen) der Wirtszelle produziert so anhand der viralen RNA-Vorlage die virusspezifischen Proteine (S, M, E, N, RNA-Polymerase).[73]
(6) Die RNA trägt die genetische Information des Virus. Sie wird als dessen Erbsubstanz in der Wirtszelle durch Kopieren vervielfältigt (RNA-Replikation). Dazu sind die Enzyme der Wirtszelle nicht in der Lage; diese Aufgabe übernimmt die virale RNA-Polymerase und stellt zahlreiche Kopien der gesamten Virus-RNA her.
(7) Sind in der Wirtszelle virale RNA-Kopien und Virusproteine in hinreichender Menge hergestellt, werden sie in das endoplasmatische Retikulum (ER) aufgenommen und lagern sich dort zu neuen Viren zusammen (Selfassembly).[74]
(8) Die fertigen Viruspartikel werden als Golgi-Vesikel aus dem ER abgeschnürt (Knospung).
(9) Durch Exozytose gelangen die Viren aus der Wirtszelle und liegen nun als Virion vor, womit wiederum mögliche Wirtszellen infiziert werden können (siehe 1).
Umweltfaktoren
Ein weiterer Beschleunigungsfaktor für die Ausbreitung des Virus könnte in der Außentemperatur liegen, da sich das Virus laut einer chinesischen Studie bei 4 Grad Celsius als besonders persistent (langfristig aktiv) erwiesen hat.[75] In der Luft liegt die kürzeste Überlebensdauer des Virus bei Raumtemperatur und mittlerer Feuchte, was mit den virentötenden Sauerstoffradikalen (ROS) zu tun haben könnte.[76] Weitere Untersuchungen erweisen UV-Licht zur Vitamin-D-Produktion, höhere Temperaturen und Wind als limitierende natürliche Faktoren für die Ausbreitung des Virus.[77] Eine Saisonalität von Sars-Cov-2 könnte in mittleren Breiten mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt von Wasser und einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent oder von 68 bis 88 Prozent einhergehen (also hierin zwei notwendige Bedingungen haben), während Bevölkerungsdichte, menschliches Verhalten, bevorzugte Aufenthaltsorte über Tag, medizinische Versorgung, Immunabwehr, Virusmutationen und Impfungen als maßgebliche Faktoren zu gelten haben, wenn es um den Verlauf und die Phasen dieser wie anderer Pandemien geht. In den Regionen der subtropischen Klimazone scheinen hohe Temperaturen die Ansteckung mit Sars-Cov-2 zu fördern; so etwa in Indien in der Zeit vor und während des Monsuns, wenn die Menschen wegen Hitze und Nässe zu Hause bleiben.[78] Eine Übertragung durch Schmierinfektion wurde hingegen nicht beobachtet, ist aber nicht ganz auszuschließen.[79][80][81] Im März 2021 publizierte die Wissenschaftsfachzeitschrift PNAS das Forschungsergebnis einer internationalen Forschergruppe unter der Leitung von Forschern der Technischen Universität München, laut dem eine hohe Pollenkonzentration in der Luft signifikant korreliert mit deutlich steigenden SARS-CoV-2-Infektionsraten.[82] Die Hoffnung auf Entspannung durch frühjahrsbedingte höhere Temperaturen wäre dadurch konterkariert. Dem üblichen Einwand, es sei nur eine Korrelation, entgegnen die Forscher, dass eine mögliche Kausalität besteht, dass der menschliche Organismus bei zunehmender Pollenkonzentration in der Luft weniger antivirale Interferone produziere, die potenziell vor einer Ansteckung schützen.[83]
Virusvarianten
Entstehung
Seitdem das Coronavirus SARS-CoV-2 den menschenlichen Organismus infiziert und sich explosionsartig in der Welt ausgebreitet hat, erwerben die „neuartigen“ Coronaviren trotz Korrekturaktivität der viralen Exonuklease eine zunehmende Anzahl von polymorphen Nukleotidsequenzen in verschiedenen Leserastern des viralen Genoms, anhand derer diese Varianten in sog. »Linien« (englisch lineages) unterteilt werden.[84] Bei den Mutationen des Virus werden unterschieden:
- Synonyme Mutationen (stille Mutationen) die sich nicht auf die codierten Proteine auswirken, da das veränderte Codon für dieselbe Aminosäure steht.
- Nichtsynonyme Mutationen mit Auswirkungen auf den Phänotyp (das Erscheinungsbild des Virus in all seinen Ausprägungen). Diese weisen offenbar bei SARS-CoV-2 auf fortlaufende Anpassung an seinen neuen menschlichen Wirt hin (dynamische Emergenz). Wichtig für die Entwicklung von Antikörpern und Impfstoffen ist es, herauszufinden, welche Teile der kodierten Proteine stabil bleiben und konserviert werden, damit die Mittel durch Anpassung der Viren nicht schnell wirkungslos werden.[5]
Mutationen können die Infektiosität von SARS-CoV-2 erhöhen[85][86]
Benennung der Virusvarianten
Um eine Stigmatisierung von Ländern zu vermeiden, benennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 seit dem 31. Mai 2021 mit Buchstaben aus dem Griechischen Alphabet. Nach dem neuen Schema heißt die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Virusvariante B.1.1.7 nun Alpha (α) und die in Südafrika entdeckte B.1.351 nun Beta (β). Die Subkladen und B.1.617.1 und B.1.617.2, der erstmals in Indien nachgewiesene Virusvariante B.1.617, werden nun mit Kappa (κ) bzw. Delta (δ) bezeichnet. Die vormals „brasilianische Variante“ genannte Virusvariante P.1 erhielt die Bezeichnung Gamma (γ).[87][88][89]
Alpha: B.1.1.7 (Großbritannien)
Im Dezember 2020 wurde in der britischen Grafschaft Kent die Variante VOC-202012/01 (auch mit B.1.1.7, VUI-202012/01 und N501Y.V1 bezeichnet[90]) des Coronavirus SARS-CoV-2 mit den Mutationen 69-70del, P681H und N501Y (letztere am Spike-Protein) festgestellt.[91][92] Diese hat nach Mitteilung der britischen Regierung vom 19. Dezember 2020 gegenüber den anderen Varianten bereits die Oberhand gewonnen.[93][94] Die New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) ist der Ansicht, dass sich der neue Virusstamm, zu dem auch Varianten mit der Mutation P681H oder der Deletion von H69 und V70 im Spike-Protein gehören, schneller verbreiten kann;[95][96][97] die molekulare Ursache könnte im Fall der N501Y-Mutation die bessere Bindung an den menschlichen Zellrezeptor ACE2 des viralen Spike-Proteins sein,[98][62] während die Deletion von H69 und V70 die Bindung mancher menschlicher Antikörper an das Spike-Protein verschlechtern könnte.[98] Mit Stand März 2021 wurde die B.1.1.7-Variante in 82 Ländern nachgewiesen.[99] Von Ende Januar 2021 bis zur zweiten Märzwoche stieg der Anteil der britischen Variante an den in Deutschland positiven SARS-CoV-2-Proben von 6 % auf 72 %.[100] Eine Auswertung britischer Daten zeigt eine Zunahme des Reproduktionsfaktors R um 43–90 % im Vergleich zum Wildtyp. Ähnliche Beobachtungen liegen aus den USA und Dänemark vor.[99] Eine Kohortenstudie aus dem Vereinigten Königreich kam auf Basis von rund 100.000 Krankheitsverläufen zu dem Schluss, dass die Variante das Sterberisiko um rund 64 % gegenüber dem Wildtypvirus erhöhe.[101]
Beta: B.1.351 (Südafrika)
Am 18. Dezember 2020 meldete das südafrikanische Gesundheitsministerium die Entdeckung der Variante N501Y.V2 aus der Linie B.1.351.[102][12] Sie weist ebenfalls die N501Y-Mutation auf, deren Auftreten anscheinend unabhängig vom Auftreten in der südenglischen Grafschaft Kent ist. Diese Variante soll möglicherweise noch ansteckender sein und auch bei jungen Leuten einen schweren Krankheitsverlauf verursachen können.[92][103][104][105] Am 8. Februar 2021 wurde diese Variante bereits in mehr als 30 Ländern nachgewiesen.
In Österreich gibt es z. Z. (Stand: Februar 2021) Hinweise darauf, dass sich in Teilen des Bundeslands Tirol die südafrikanische SARS-CoV-2-Mutante verstärkt ausbreitet. Derzeit wird etwa die Hälfte der dort durch eine Mutation verursachten Infektionen auf diese Variante des Virus zurückgeführt. 80 % der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 würden vom ursprünglichen Virus, dem Wildtyp, verursacht und jeweils 10 % von der britischen oder südafrikanischen Variante, wie die Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.[106]
B.1.617 (Indien) mit Subkladen Kappa: B.1.617.1 und Delta: B.1.617.2
Charakteristik der Delta-Variante
Diese Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 trägt die wissenschaftliche Bezeichnung B.1.617. Erstmals nachgewiesen wurde B.1.617 im Oktober 2020 im indischen Bundesstaat Maharashtra.[107]
Bei B.1.617 wurden durch Mutation drei Aminosäuren im Spike-Protein ausgetauscht. Die Mutationen E484K und E484Q führten zu einer reduzierten Wirksamkeit der humoralen Immunantwort, während die Mutation L452R sowohl eine reduzierte Wirksamkeit der humoralen als auch der zellulären Immunantwort zu folge hatte.[108]
Die Klade B.1.617 wird nochmals in die Subkladen B.1617.1 (Kappa-Variante). und B.1.617.2 (Delta-Variante) unterteilt, wobei letztere nicht die Mutation E484Q aufweist. Es gibt Hinweise darauf die Delta-Variante (B.1.617.2) bedingt durch eine stärkere Bindung des Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor der Wirtszellen, ansteckender ist als der Wildtyp von SARS-CoV-2.
Entsprechend dem Kentnissstand der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) Anfang Juni 2021 kann die Delta-Variante (B.1.617.2) von SARS-CoV-2 häufiger zu schwereren Covid-19-Erkrankungen führen als die die zunächst in Großbritannien entdeckte Alpha-Variante (B.1.1.7) des Virus. Laut einer Risikoeinschätzung der Behörde legen erste Erkenntnisse aus England und Schottland nahe, dass es ein höheres Risiko für Krankenhauseinlieferungen geben könnte als bei der Alpha-Variante. Deutlichere Belege gebe es hingegen dafür, dass die Delta-Variante deutlich ansteckender ist als die Alpha-Variante.[109]
B.1.617 wird seit dem 11. Mai 2021 von der WHO zu den „besorgnisseregenden Varianten“ (englisch Variants of concern, VOC) gezählt.[108] Bis Ende April 2021 wurde B.1.617 in verschiedenen Ländern nachgewiesen, darunter dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien, den Vereinigten Staaten, Australien und Singapur.[110] In Deutschland machte sie Anfang Mai 2021 rund 2% der sequenzierten Proben aus.[108][111]
Schutzwirkung der Corona-Impfstoffe
In einer Studie von Mehul Suthar et al. wurde nach Analyse von Neutralisationstests bei Genesenen oder mit mRNA-Impfstoffen Geimpften gefolgert, dass die Schutzwirkung dieser Impfstoffe gegenüber B.1.617 wahrscheinlich erhalten bleibe.[112]
Gamma: P.1 (Brasilien)
Am 10. Januar 2021 wurde eine neue Variante aus Brasilien gemeldet, die im brasilianischen Bundesstaat Amazonas zirkuliert.[113] Sie ähnelt den aus England und Südafrika bekannten Varianten und weist ebenfalls die N501Y-Mutation auf.[114][102][115][116] Die brasilianische Mutante stammt von der Linie B.1.1 ab und wird als 501Y.V.3 oder auch Lineage P.1 bezeichnet.[113][117] Am 22. Januar 2021 wurde bekannt, dass die brasilianische Variante erstmals in Deutschland gefunden worden war. Bei einem aus Brasilien kommenden Hessen, der am Flughafen Frankfurt eingereist war, konnte eine Infektion mit der Mutante mittels PCR-Test nachgewiesen werden. Eine DNA-Sequenzierung stand zu diesem Zeitpunkt jedoch noch aus. Ebenso wie die britische und südafrikanische Variante steht diese Mutante im Verdacht, ansteckender zu sein als der Wildtyp des Coronavirus SARS-CoV-2. Laut Aussage der Virologin Sandra Ciesek gibt es (Stand Mitte Januar) keine Hinweise darauf, dass diese Varianten schwerere Verläufe verursachen als der Wildtyp des Virus.[118]
Im Département Moselle, das an das Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg grenzt, sind auffallend hohe Häufungen der südafrikanischen und brasilianischen Virus-Mutanten registriert worden. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran sagte, vom 8. bis 11. Februar 2021 seien 300 Fälle der südafrikanischen und brasilianischen Mutanten nachgewiesen und in den Tagen zuvor weitere 200 Fälle.[119]
B.1.525
B.1.525 vereint Genveränderungen der britischen und der südafrikanischen Variante. Sie ist in mehreren Ländern nachgewiesen worden, zum Beispiel in Dänemark, Italien, Nigeria, Norwegen, Kanada, Großbritannien und den USA. Am 9. März 2021 wurde gemeldet, B.1.525 sei in Deutschland erstmals nachgewiesen worden, und zwar am Flughafen BER. Das Unternehmen Centogene, das die Probe analysiert hat, teilte kurz darauf mit, die Variante sei auch schon in anderen Proben nachgewiesen worden. B.1.525 enthält die Mutation E484K.[120]
Sonstige Varianten
- Am 24. Dezember 2020 wurde bekannt, dass in Nigeria eine neue Variante von SARS-CoV-2 aufgetaucht ist, die sich offenbar von der britischen und südafrikanischen unterscheidet.[121]
- Am 19. Januar 2021 wurde eine kalifornische Variante, L452R, bekannt, die sich von der britischen unterscheidet.[122][123]
- Am 19. Februar 2021 wurde die finnische Variante, Fin-796H, bekannt.[124]
- Seit Februar 2021 grassiert in New York City eine neue Mutante (Linie B.1.526), die Gemeinsamkeiten mit der südafrikanischen und brasilianischen Mutante hat.[125][123]
- Am 10. März 2021 wurde bekannt, dass fast 40 % der in örtlichen Laboren untersuchten COVID-Infektionen B.1.526-Infektionen sind.[126]
- Am 15. März 2021 wurde in der Bretagne (Frankreich) eine Variante entdeckt. Es handelt sich um SARS-CoV-2 der „Clade 20C mit 9 Mutationen im Spike-Protein“. Dies seien „S:H66D, S:G142V, S:D215G, S:V483A, S:D614G, S:H655Y, S:G669S, S:Q949R, S:N1187D“ und folgende Deletionen: „ORF6:K23-, ORF6:V24-, ORF6:S25-, ORF6:I26-, ORF6:W27-, ORF6:N28-, ORF6:L29-, ORF6:D30-, ORF6:Y31-, S:Y144-.“ Die Mutationen sind dem RKI zufolge über das gesamte Genom verteilt. Zunächst wurde befürchtet, dass die Variante sich mittels PCR-Verfahren schlechter nachweisen ließe, was sich bisher nicht bestätigte (Stand: Ende April 2021). Durch die fehlende Mutation N501Y ist sie nicht wie andere Varianten leichter übertragbar.[127][128]
- Am 22. Mai 2021 wurde gemeldet, dass sich in Bordeaux VOC 20I/484Q stark ausbreitet, die mit der britischen Variante verwandt ist und zusätzlich die Mutation "E484K" der südafrikanischen und brasilianischen Variante aufweist. Da befürchtet wird, VOC 20I/484Q könne sehr ansteckend sein und resistenter gegen die aktuellen Impfstoffe, wurde für den Stadtteil Bacalan eine beschleunigte Impfkampagne gestartet.[129]
- In Vietnam wurde ein neuer Strang des Coronavirus entdeckt. Nach Angeben der WHO handele es sich nicht um eine neue Variante. Die bei Gen-Sequenzierungen gefundene Mutation sei vielmehr ein Strang der zuerst in Indien aufgetretenen Variante B.1.617. Sie weise einige weitere Mutationen auf und werde nun intensiv beobachtet.[130]
Variantenklassifizierungsschema
Eine Beratergruppe der US-Regierung hat ein Schema entwickelt, nach dem die SARS-CoV-2-Varianten drei Klassen zugeordnet werden können:[131]
- Variant of Interest (VOI) – Variante von Interesse. Es handelt sich um eine Variante mit spezifischen genetischen Markern, in Verbindung gebracht werden:
- die mit Änderungen der Rezeptorbindung
- einer verringerten Neutralisation durch Antikörper, die gegen frühere Infektionen oder Impfungen erzeugt wurden
- einer verringerten Wirksamkeit der Behandlung
- potenziellen diagnostischen Auswirkungen oder
- einer vorhergesagten Zunahme der Übertragbarkeit oder
- der Schwere der Erkrankung.
- Variant of Concern (VOC) – Besorgniserregende Variante. Bei dieser Variante gibt es Hinweise auf:[132]
- eine Zunahme der Übertragbarkeit, einer schwereren Erkrankung (vermehrte Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle),
- eine signifikante Verringerung der Neutralisation durch Antikörper, die während einer früheren Infektion oder Impfung erzeugt wurden,
- eine verminderte Wirksamkeit von Behandlungen oder Impfstoffen oder
- diagnostische Erkennungsfehler.
- Die Varianten B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.427 und B.1.429 waren im März 2021 als Variant of Concern klassifiziert.[133]
- Variant of High Consequence (VOHC) – Variante von hoher Bedeutung. Dieser Klasse werden Varianten zugeordnet bei:
- Nachweis von Fehldiagnosen
- signifikanter Verringerung der Wirksamkeit des Impfstoffs,
- einer unverhältnismäßig hohen Anzahl von Krankheitsausbrüchen trotz Impfung
- einem sehr geringen Schutz gegen schwere Krankheiten trotz Impfung
- eine deutlich verringerte Wirksamkeit der Pharmazeutika mit Notfallzulassung oder regulärer Zulassung
- schwerwiegenden klinischen Erkrankungen und Anstieg der Krankenhausaufenthalte
- Variant under Investigation (VUI) – Variante unter Beobachtung.[134][135][136][137] Diese Klassifizierung wird insbesondere bei einer neu entdeckten Variante verwendet, über die noch nicht viel bekannt ist, aber Grund zur Annahme besteht, dass sie in eine der anderen Kategorien hochgestuft werden könnte, weil sie zum Beispiel:
- ähnliche Mutationen von gefährlicheren Varianten aufweist
- in zeitlich und/oder räumlicher Nähe gehäuft auftritt
- bei Tests und Diagnosen schwieriger zu identifizieren ist
- auffällige Krankheitsverläufe beobachtet wurden
Zeitliches Verhalten und räumliche Ausbreitung
Einen Stammbaum der bis Ende Februar 2020 bekannten SARS-CoV-2-Isolate, der ihre Verwandtschaft untereinander zeigt, findet man bei Li et al.[138] Die Isolate gliederten sich in zwei Hauptgruppen (L-Typ nach der Aminosäure Leucin und S-Typ nach Serin), was Anlass zur Vermutung gab, das Virus könnte sich in zwei (unterschiedlich infektiöse) Zweige aufgeteilt haben.[139][140] Allerdings war es nach Meinung anderer Experten Anfang März 2020 noch zu früh, darüber eindeutige Aussagen machen zu können.[141][142][143][144] Die in beiden Hauptzweigen des Stammbaums basal liegenden Isolate stammen aus Wuhan, was ein Beleg dafür war, dass das Virus dort seinen Ausgang genommen hat. Gleichwohl ist nicht ausgeschlossen, dass es einen unbekannten Vorläufer von anderswo, etwa aus der chinesischen Provinz Yunnan, in Tieren oder Menschen, gegeben haben könnte; auch das Einschleppen nach China durch den Import von Wirtstieren ist nicht auszuschließen (→ Herkunft und Wirtsspektrum).
Eine weitere Studie Anfang April 2020 machte drei Stämme A, B und C aus. Stamm A war dem Fledermausvirus BatCoV/RaTG13 am ähnlichsten und scheint sich von Wuhan aus weltweit verbreitet zu haben; in Festlandchina selbst war aber Stamm B vorherrschend, der außer in China auch andernorts in Ostasien verbreitet war. Stamm C war der hauptsächliche Typ in Europa.[145][146]
Das Virus mutiert offenbar relativ langsam – ein bis zwei Mutationen pro Monat wurden beobachtet (zum Vergleich: Influenzaviren mutieren zwei- bis viermal so häufig).[147][148] Das bedeutet zum einen, dass es per Genomanalyse keine sehr hohe Auflösung bezüglich der Ausbreitungswege des Virus gibt, zum anderen lässt es darauf hoffen, dass eine nach überstandener Krankheit erworbene Immunität lange (monatelang) anhält. Allerdings hatten isländische Virologen von deCODE Genetics (isländisch Íslensk erfðagreining) bis zum 24. März 2020 vierzig verschiedene Mutationen allein bei Infizierten aus diesem Land identifiziert.[149][150][151] Eine der Betroffenen war mit zwei verschiedenen Ausprägungen von SARS-CoV-2 coinfiziert.[152][153]
Die im Westen dominierende Form des Virus, die sich ab Februar 2020 in Europa stark ausbreitete und von dort auch in andere Länder, hat eine Mutation D614G im Spike-Protein[154][155][156][157] und weicht damit von der Wuhan-Variante ab. Insbesondere hat diese Mutation vier- bis fünfmal mehr Spikes auf der Oberfläche des Virus.[158]
In einer italienischen Studie vom Juli 2020 wurden zu diesem Zeitpunkt sechs SARS-CoV-Varianten unterschieden. Stamm G ist in Europa am häufigsten, dieser ist seit Ende Februar 2020 weiter mutiert in die Stämme GR und GH. Der ursprüngliche Stamm L aus Wuhan wird immer weniger gefunden, wie auch der Stamm V. Ein Stamm S wurde in einigen Gebieten der USA und Spaniens gefunden.[147]
Der Anteil der britischen, südafrikanischen und brasilianischen SARS-CoV-2-Mutanten (Varianten) an den Infektionszahlen kann anhand einer neuen Überprüfungsmethode, die von einem gemeinsamen Nukleotid der drei Mutanten ausgeht, schneller ermittelt werden. Diese Untersuchungen sollen zweimal im Februar und einmal Anfang März 2021 in Deutschland wiederholt werden.[159]
Herkunft und Wirtsspektrum
Seit dem Bekanntwerden der Viruskrankheit werden verschiedene Tiergruppen als Ursprung oder zumindest Überträger des Erregers diskutiert. Eine molekulare Datierungsschätzung mittels Genom-Vergleich der verschiedenen SARS-CoV-2-Isolate legt einen Ursprung der Virusvariante im November 2019 nahe.[28][138] Van Dorp und ihre Kollegen ermittelten aufgrund phylogenetischer Analysen der verschiedenen Virusvarianten Anfang Mai 2020, dass das Virus zwischen dem 6. Oktober und dem 11. Dezember 2019 auf den Menschen übergesprungen sein dürfte.[5]
Eine vergleichende Studie zum Infektionsrisiko von SARS-CoV-2 / COVID-19 wurde im August 2020 von Joana Damas et al. vorgelegt. Danach ist das Bindungspotential des Spike-Proteins an den jeweiligen ACE2-Rezeptor bei Primaten (Mensch, Bonobo, Gemeiner Schimpanse, Westlicher Flachlandgorilla) am größten, bei folgenden Spezies dagegen sehr gering: Kalifornischer Seelöwe, Hausmaus, Amerikanerkrähe und Mississippi-Alligator.[160] Insgesamt können mehr als 60 Säugetier-Arten von SARS-CoV-2 infiziert werden, darunter auch Füchse, Yaks, Riesenpandas und Koalas. (Stand: 6. November 2020).[161]
Schlangen und Vögel
Fachleute vermuteten zu Beginn der Epidemie in China, dass als Hauptwirt ein anderes Säugetier oder Geflügel infrage komme. Der Übergang vom Tier auf den Menschen könne jedoch über einen noch nicht identifizierten Zwischenwirt erfolgt sein.[162] Chinesische Forscher verwiesen im Journal of Medical Virology auf Schlangen wie den Vielgebänderten Krait (Bungarus multicinctus) und die Chinesische Kobra (Naja atra),[163][164] die auf dem Großmarkt, der als Infektionsort der ersten Infizierten vermutet wird, neben anderen lebenden Wildtieren (sogenannten Ye Wei) wie Fledermäusen oder Kaninchen angeboten werden.[165] Diese Hypothese wurde von anderen Virologen für unwahrscheinlich erklärt,[166] da es bisher keine Evidenz dafür gebe, dass Coronaviren auch Reptilien infizieren können. Bisher seien Coronaviren ausschließlich bei Säugetieren und Vögeln gefunden worden.[162] Weitere Untersuchungsergebnisse zu Hühnern und Enten (Galloanserae spp.) siehe unten.
Fledertiere und Schuppentiere
Hufeisennasen – möglicherweise mehrere höhlenbewohnende Arten – waren das Reservoir des Erregers SARS-CoV[-1], der die SARS-Pandemie 2002/2003 ausgelöst hatte, mit dem Larvenroller (Paguma larvata, englisch masked palm civet) als möglichem Zwischenwirt zwischen Fledertier und Mensch. Seitdem wurden verschiedene weitere Betacoronaviren (insbesondere auch SARS-artige der Untergattung Sarbecovirus) vor allem bei Fledertieren, aber auch bei Menschen gefunden.[28]
BatCoV RaTG13
Wie im November 2020 bekannt wurde, starben bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 drei von sechs infizierten Arbeitern nach schweren Atemwegserkrankungen, die zuvor in einer stillgelegten Kupfermine beim Ort Tongguan (通关镇)[167] im Landkreis Mojiang (墨江县) in der chinesischen Provinz Yunnan mit dem Entfernen von Fledermauskot beschäftigt waren. Bei Laboruntersuchungen der Patienten und einer im Folgejahr in der Höhle stattgefundenen Expedition fand man SARS-CoV-ähnliche Viren (SARSr-CoVs, Untergattung Sarbecovirus) aus Alpha- und Betacoronaviidae. Eine teilsequenzierte Probe (RdRp) davon wurde unter BatCov/4991 in der Gendatenbak aufgenommen.[168] Erst im Frühjar 2020 wurde die Existenz einer Vollsequenzierung unter BatCoV/RaTG13 bekannt, worauf aufgrund der 100%igen Identität das Isolat BatCov/4991 aufgegeben und gelöscht wurde.[169][60]
SARS-CoV-ähnliche Coronaviren
Bis 2017 wurden in den Höhlen in Yunnan SARS-CoV-ähnliche Coronaviren in folgenden Fledermausspezies gefunden: in Hufeisennasenarten bei der Java-Hufeisennase (Rhinolophus affinis, en. intermediate horseshoe bat), der Chinesischen Hufeisennase (R. sinicus) und der Großen Hufeisennase (R. ferrumequinum); sowie in der Stoliczka-Dreizackblattnase (Aselliscus stoliczkanus, en. Stoliczka's trident bat).[52]
In Kot einer Horn-Hufeisennase[59] (Rhinolophus cornutus, en. little Japanese horseshoe bat) aus der Präfektur Iwate im Norden der japanischen Hauptinsel Honshū vom Jahr 2013 wurde im Herbst 2020 ein Rc-o319 genannter Sarbecovirus-Stamm gefunden, dessen Genom zu 81 % mit dem von SARS-CoV-2 übereinstimmt.[170][171]
BatCoV RaTG13 und SARS-CoV-2
Aufgrund der Ähnlichkeit der Bindungsstelle (en. receptor binding domain, RBD) des Spike-Proteins an den menschlichen Rezeptor ACE2 (hACE2) gilt inzwischen das Virus-Isolat BatCoV RaTG13[172] (gefunden in Java-Hufeisennasen Rhinolophus affinis, englisch intermediate horseshoe bat in Yunnan, in Bruchstücken auch bei erkrankten und verstorbenen Minenarbeitern aus Yunnan 2016)[173], als wichtiger Kandidat für den Ursprung von SARS-CoV-2, auch wenn nicht klar ist, ob die Übertragung direkt erfolgte. Die Übereinstimmungen der Gesamtgenomsequenzidentitӓt zwischen RaTG13 und SARS-COV-2, festgestellt beim Screening durch eine veröffentlichte Pan-CoV-2-PCR-Methode beträgt 96%.[174]
Zu Beginn der Pandemie kannte man praktisch keine nah mit SARS-CoV-2 verwandte Viren. Die hochaffine Bindung des SARS-CoV-2 Spike-Proteins an menschliches ACE2 ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis einer natürlichen Selektion an einer menschlichen oder menschenähnlichen ACE2, die eine optimale Bindungslösung gestattet. Dass die Genetik des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 so gut zum Menschen passt, wird immer wieder als Argument für einen Labor-Ursprung des Virus benutzt.[50][28]
Schuppentiere
Nachdem in Malaiischen Schuppentieren (Manis javanica, en. Sunda pangolin) Coronaviren mit hoher genetischer Übereinstimmung zum SARS-CoV-2 gefunden wurden (Manis-CoV, genauer Pan_SL-CoV_GD/P1L,[166] Isolate SRR10168377 und SRR10168378),[138] gerieten diese in Verdacht der Ursprung der Pandemie zu sein, obwohl Pangoline Einzeltiere sind die relativ kleine Populationsgrößen aufweisen, aber trotz Verbots in China gehandelt werden. (Rote Liste gefährdeter Arten)[47][50][175][176][177][178][166] Die Übereinstimmung betrug in diesem Fall 90 % über das gesamte Genom, aber 99 % in einer spezifischen Region des Spike-Proteins (S-Protein), die es dem Virus erlaubt, an die ACE-Rezeptoren der menschlichen Zellen zu binden.[28] Interessanterweise ist das in den Java-Hufeisennasen (R. affinis) isolierte Virus RaTG13 gerade in diesem Genom-Abschnitt zu SARS-CoV-2 mit nur 77 % Übereinstimmung vergleichsweise unterschiedlich.[28] Dies bedeutet, dass die aus den Malaiischen Schuppentieren isolierten Coronaviren in menschliche Zellen eindringen können, das aus Java-Hufeisennasen isolierte jedoch nicht.[28] Außerdem ist dieses Ergebnis verträglich mit der Annahme, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis einer Rekombination der RNA-Moleküle zweier verschiedener Viren sein könnte, eines dem RaTG13 aus Fledermäusen von Yunnan, das andere dem Pan_SL-CoV_GD aus den Schuppentieren von Guangdong nahestehend. Dann wäre SARS-CoV-2 entstanden als eine neue Chimäre aus zwei Viren, die diesen beiden Linien jeweils sehr nahestanden.[28][179] Diese Annahme wurde durch eine weitere Studie von Xiaojun Li und Kollegen (Duke University, Los Alamos National Laboratory, University of Texas, El Paso und New York University) Ende Mai 2020 unterstützt.[180][181][182]
Zwar besitzen Coronaviren – anders als etwa Influenzaviren – ein unsegmentiertes Genom (monopartit), d. h. nur ein einziges Nukleinsäuremolekül (hier RNA). Eine Rekombination von Segmenten als Ganzes (Reassortment) ist also im Gegensatz zu diesen nicht möglich. Insbesondere um den Ursprung des alten SARS-Virus SARS-CoV[-1] zu erklären, wurde bereits früher bei dieser Virusfamilie ein Rekombinationsmechanismus, und zwar innerhalb des (einzigen) Genom-Segments, beschrieben (homologe Rekombination).[28][183] Eine solche Rekombination kann, egal ob segmentiertes oder unsegmentiertes Genom, zu einem neuen Virus führen, das eine neue Wirtsspezies befallen und krank machen kann.[28] Das Rekombinationsereignis kann daher zum Ausgangspunkt einer neuen Epidemie werden, wie es bei SARS vermutet (und bei Influenza stets befürchtet) wird. Voraussetzung ist die Doppelinfektion (Koinfektion) eines (einzelnen) Wirtsindividuums durch die beiden Ausgangsviren.[28] Allerdings bleibt bislang (Stand 2. Juni 2020) ungeklärt, in welcher Spezies die hypothetische Doppelinfektion stattgefunden haben könnte, und unter welchen Umständen dies geschehen sein könnte. Bei den konfiszierten Pangolinen die in Quarantӓnezentren untergebracht wurden konnten hochspeziefische SARS-CoV-2 Antigene festgestellt werden.[28]
Alternatives Szenario
Als alternatives Szenario, das ohne Rekombination auskommt, wird verschiedentlich etwa folgendes vorgeschlagen: Die gemeinsamen Vorfahren von RaTG13 und SARS-CoV-2 stammen danach ursprünglich von den Schuppentier-Coronaviren ab, von deren SARS-CoV-2-ähnlichstem Stamm sie sich vor mehr als 140 Jahren trennten. Diese Linie spaltete sich vor etwa 40–70 Jahren erneut auf: eine Linie verblieb in Fledermäusen und verlor dort die Bindungsfähigkeit ihres Spike-Proteins an das menschliche ACE2 (hACE2). Die andere behielt diese Fähigkeit und sprang zuletzt als SARS-CoV-2 auf den Menschen über.[184] Die verschiedenen Möglichkeiten werden auch von Halloy et al. in einem PrePrint vom Juli 2020 diskutiert.[173] Auch Boni et al. vertreten Ende Juli 2020 die Ansicht, dass SARS-CoV-2 nicht direkt aus einer Rekombination von Fledermaus- und Schuppentier-Coronaviren hervorgegangen ist, sondern dass sich seine Entwicklungslinie von der des Fledermausvirus RaTG13 vor ca. 50 Jahren getrennt hat.[185]
Weiteres zu Nilflughunden siehe unten (Abschnitt Weitere Wirbeltiere).
Anfang Dezember 2020 wurde erstmals über Funde SARS-CoV-2-ähnlicher Coronaviren bei Fledermäusen außerhalb Chinas berichtet. Neben dem oben erwähnten Fund von Rc-o319 bei der Horn-Hufeisennase aus Japan könnte man bei zwei bereits im Jahr 2010 eingefrorenen Exemplaren der Kochang-Hufeisennase[59] (Rhinolophus shameli, en. Shamel's horseshoe bat) aus dem Norden Kambodschas fündig geworden sein, die Genom-Analyse ist aber erst zu 70 % abgeschlossen (Stand 6. Dezember 2020). Die Ergebnisse von Fledermausstudien waren jedoch im Allgemeinen beruhigend. Eine Untersuchung der ACE2-Rezeptoren in den Zellen von 46 Fledermausarten ergab, dass die Mehrheit schlechte Wirte waren. Einige Arten, wie z. B. Fruchtfledermäuse (Rousettus aegyptiacus), die infiziert wurden konnten die Infektion auf andere Fledermäuse übertragen.[170][186]
Marderhunde als mögliche Zwischenwirte
Laut Christian Drosten könnten Marderhunde (Nyctereutes procyonoides, eine Fuchsart) möglicherweise die gesuchten Zwischenwirte sein. Auch das ursprüngliche SARS-Virus (SARS-CoV-1) wurde in Marderhunden gefunden, die wegen ihres Fells in China gezüchtet werden und somit als Überträger auf den Menschen in Frage kommen.[187][188][189][190]
Haustiere als Wirte
Haushunde und Hauskatzen waren die ersten Tiere, bei denen es im Haushalt ihrer Besitzer zu Übertragungen von Mensch zu Tier kam. Testtiere beider Arten wurden daher auch in Laborexperimenten infiziert, um den Verlauf der Krankheit und mögliche Rückübertragungen auf den Menschen zu erforschen. Einer im September 2020 publizierten Studie zufolge gibt es keine Hinweise für eine Rückübertragung der Viren auf den Menschen, wohl aber Belege dafür, dass die Immunantwort von infizierten Tieren beider Arten diese vor einer zweiten Infektion schützt.[191] Laut WHO gab es bereits im März 2020 Hinweise, dass Haustiere SARS-CoV-2 nicht als Träger weiterverbreiten.[192] Jedoch können einige andere Viren aus der Virusfamilie Coronaviridae auch bei Haustieren Erkrankungen auslösen, z. B. die beiden Alphacoronaviren CCoV (Hunde) und FCoV (Katzen).[193]
Nachfolgend einige Beispiele für die Erkrankungen bei Haustieren.
Hunde
Am 28. Februar 2020 gab die Regierung Hongkongs bekannt, erstmals einen Hund positiv auf das Virus getestet zu haben, der im Haushalt seiner infizierten Halter lebte.[194] Die WHO bestätigte, die SARS-CoV-2-Proben seien „schwach positiv“[195] getestet worden. Obwohl bei dem Hund das Virus im Blut nachgewiesen werden konnte,[196] löste es bei ihm keine klinisch nachweisbaren Hinweise auf eine Erkrankung aus.[197] Das Tier wurde zuletzt am 12. und 13. März 2020 mit negativem Befund auf SARS-CoV-2 getestet, so dass seine Quarantäne beendet und es dem Besitzer zurückgegeben wurde. Zwei Tage nach Ende der Quarantäne verstarb der Hund, ohne dass ein direkter Zusammenhang mit dem Virusbefall nachweisbar war.[198]
Mitte März 2020 wurden in Hongkong zwei weitere Hunde positiv auf SARS-CoV-2 getestet, die ebenfalls ohne auffällige Symptome einer Infektion waren.[199] Aus Japan wurde im September 2020 bekannt, dass dort zwischen April und August vier Hunde von an SARS-CoV-2 erkrankten Haltern positiv getestet, ohne auffällige Symptome einer Infektion isoliert und nach wiederholtem, negativem Test an ihre gesundeten Halter zurückgegeben worden waren.[200]
Mitte April 2020 erschien ein Artikel über die Möglichkeit von streunenden Hunden als Zwischenwirt für die Übertragung von Sarbecoviren (RaTG13, Pangolin-CoV) von Wildtieren (Fledermäusen, Schuppentieren) auf den Menschen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Zinkfingerprotein ZAP.[201]
Wenn Viren in einen Organismus eindringen, dann wehrt er sich. Und diese "Kampfspuren" kann man später am Virus nachweisen bzw. an der Art, wie es sich verändert. Und genau das hat Professor Xuhua Xia untersucht. Dabei stellte er fest, dass nur die Corona-Viren von Hunden (CCoVs) die gleiche Reaktion bei den Viren verursacht hatten wie im Fall des neuen Sars-CoV-2 und beim ursprünglichen Fledermausvirus BatCoV RaTG13.[202]
Bei einer experimentellen Studie wurden drei Hunde mit dem Virus infiziert. Keiner der Hunde zeigte klinische Zeichen einer Infektion und es konnte auch keine Ausscheidung von vermehrungsfähigem Virus nachgewiesen werden.[203]
Katzen
In Lüttich (Belgien) wurde Ende März 2020 die Hauskatze eines Infizierten positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Das Tier litt vorübergehend an Durchfall, Erbrechen und erschwerter Atmung.[204][205] Eine Ende März 2020 in Hongkong bei einer Hauskatze nachgewiesene Infektion verlief hingegen symptomlos.[206] Antikörpernachweise hatten zuvor bereits in Wuhan ergeben, dass dort auch Katzen infiziert worden waren.[207] Zudem wurde mehrfach in Laborexperimenten belegt, dass infizierte Katzen die Viren an andere Katzen weitergeben können.[208][209][210] Es besteht der Verdacht, dass eine Katze das Virus zwischen Bewohnern eines Altenheims in Bayern übertragen haben könnte, obwohl sie voneinander isoliert waren.[211] Eine weitere infizierte Katze wurde in Barcelona untersucht. Das Tier war wegen einer Herzerkrankung eingeschläfert worden, jedoch ergab die Autopsie, dass es nicht an, sondern mit SARS-CoV-2 am Herz erkrankt war.[212] Auch in der Schweiz wurde das Virus Ende 2020 bei einer Katze nachgewiesen.[213]
Eine experimentelle Studie, bei der sieben Katzen infiziert worden waren, zeigte, dass diese rund fünf Tage übertragbares Virus ausschieden und auch andere Katzen infizieren konnten. Keine der untersuchten Katzen zeigte klinische Zeichen einer Infektion. Die durchgemachte Infektion schützte die Tiere im Falle einer Reexposition mit dem Virus. Ein Team unter der Leitung des Virologen Bu Zhigao führte Proben des SARS-CoV-2-Virus in die Nase von fünf Hauskatzen ein. Als zwei der Tiere sechs Tage später eingeschläfert wurden, fanden die Forscher virale RNA sowie infektiöse Viruspartikel in ihren oberen Atemwegen. Die anderen drei infizierten Katzen wurden neben nicht infizierten Katzen in Käfige gesetzt. Das Team entdeckte später virale RNA in einer dieser exponierten Katzen, was darauf hindeutet, dass es das Virus aus Tröpfchen kontrahierte, die von den infizierten Katzen ausgeatmet wurden. Alle vier infizierten Katzen produzierten auch Antikörper gegen SARS-CoV-2. Die Überwachung auf SARS-CoV-2 bei Katzen sollte als Teil der Bemühungen zur Eliminierung von COVID-19 beim Menschen betrachtet werden. Als Sporadische Infektionsquelle bei Menschen könnten Katzen nicht ausgeschlossen werden, sagte Jan Felix Drexler, Virologe am Charité-Krankenhaus in Berlin.[214][215][186] Laut chinesischen Berichten wurden bereits seit 2019 ungefähr 30.000 Wild,- Zucht- und Haustiere wissenschaftlich auf entsprechende Infektionen getestet. Lediglich im März 2020 entdeckte man dabei in Wuhan einige wahrscheinlich infizierte Katzen.[216]
Marderverwandte
Im April und Mai 2020 wurden erstmals Infektionen und Erkrankungen von Amerikanischen Nerzen (Neovison vison, wie im Englischen auch Mink genannt) festgestellt, und zwar in mehreren niederländischen Nerz-Farmen. Die erkrankten Nerze zeigten ähnliche Symptome wie erkrankte Menschen: Atemwegsbeschwerden, Probleme mit dem Verdauungstrakt, erhöhte Sterblichkeit.[217] Auch in der vom Feinstaub belasteten Luft der Tierhaltungen wurde virale RNA nachgewiesen.[218][219] Das Virus sei – so die anfängliche Vermutung – von infizierten Mitarbeitern eingeschleppt und danach von Tier zu Tier weitergegeben worden.[220] Detaillierte Analysen des genetisches Codes der in den Farmen und im Umland der Farmen umlaufenden SARS-CoV-2-Varianten erbrachten zudem Anhaltspunkte dafür, dass sich zwei infizierte Mitarbeiter der Farmen bei den Nerzen angesteckt haben und dass zudem mehrere im Bereich der Farmen frei laufende Katzen ebenfalls „farm-typische“ SARS-CoV-2-Varianten aufwiesen,[221] weswegen auch sie als mögliche Überträger von Viren auf die Nerze infrage kommen.[222] Auch gab es Hinweise darauf, dass das Virus zwischen Mensch und Amerikanischem Nerz hin- und zurück gesprungen ist, dass also eine Übertragung zoonotisch (von Nerz auf Menschen) möglich ist; untersucht wurden Ausbrüche auf 16 Nerzfarmen.[223] Nach Ansicht der WHO-Expertin Maria Van Kerkhove ist das Risiko einer Ansteckung des Menschen durch ein solches Tier jedoch nur „sehr begrenzt“.[224] Eine ausführliche Stellungnahme mit Empfehlungen zum Umgang mit Nerzen hat die Europäische Gesundheitsbehörde (ECDC) am 12. November 2020 abgegeben.[225]
Im US-Bundesstaat Utah wurden zwischen Juli und September 2020 – nach auffälligen Häufungen von Todesfällen in mehreren Zuchtbetrieben – ebenfalls infizierte Nerze entdeckt. Ein wilder Nerz, der in Utah positiv getestet wurde, „könnte nur die Spitze des Eisbergs sein“, sagte Sarah Hamer, Epidemiologin und Tierärztin an der Texas A & M University in der College Station. "Je mehr wir schauen, desto mehr könnten wir finden."[186][226] Mitte Oktober 2020 wurde bekannt, dass Massenkeulungen vorgenommen wurden. So wurden allein im US-Bundesstaat Utah fast 10.000 Tiere getötet, in Spanien über 92.000 und (von denen 90 % mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen sein sollen) in den Niederlanden über eine Million. Anfang November wurde von amtlichen Stellen in Dänemark angekündigt, sämtliche im Land gehaltenen – bis zu 17 Millionen Nerze – zu töten.[227][219] Vorausgegangen waren Erkenntnisse über Mutationen des Virus in Nerzen, gegen die einige der in Entwicklung befindlichen Impfstoffe gegen das Virus beim Menschen voraussichtlich nicht wirksam wären.[228] Die Nerzzucht in Dänemark ist ein bedeutender Wirtschaftszweig mit jährlich rund 17 Millionen Fellen in rund 1100 Zuchtfarmen, auf denen die Tiere auf engem Raum in Käfigen gehalten werden.[228] Bei den Nerzen in Dänemark wurde eine Virusvariante („Cluster 5“) entdeckt.[229] Mitte November teilte die dänische Regierung mit, dass diese Variante ausgemerzt sei.[230] Insgesamt war es bis November 2020 in sechs Ländern zu Ausbrüchen in Nerzfarmen gekommen.[231] Bis Januar 2021 wurde das Virus in Nerzfarmen von acht Ländern in der EU/im EWR nachgewiesen.[232] Dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zufolge waren für Deutschland keine besonderen Schutzmaßnahmen nötig, da es wegen des Verbots der Haltung von Nerzen als Pelztiere in Deutschland keine Nerzfarmen gibt.[233] In Wuhan wurden zehn Marktstände gefunden, an denen wilde oder gezüchtete Tiere aus Farmen in Südchina verkauft wurden, darunter Kaninchen, Zibetkatzen, Waschbären und Frettchen. Peter Daszak forderte eine Untersuchung der Bestände und Mitarbeiter dieser Farmen, ob sich dort möglicherweise noch Antikörper gegen das Virus finden lassen.[216]
Durch Laborexperimente in Korea wurde belegt, dass Frettchen empfänglich für eine SARS-CoV-2-Infektion sind und die Viren auch an Artgenossen weitergeben können.[234] Das FLI bestätigte aufgrund eigener Tests den Befund aus Korea[211] und wies zugleich darauf hin, dass auch Nilflughunde empfänglich für eine SARS-CoV-2-Infektion sind, Schweine und Hühner hingegen nicht. Insbesondere die Empfänglichkeit von Frettchen sei ein wichtiger Befund, „da sie als Modelltiere für die Infektion des Menschen zur Erprobung von Impfstoffen oder Medikamenten eingesetzt werden könnten“.[235]
Ein experimentelles Vakzin gegen COVID-19 wurde an den in ihrem Bestand stark gefährdeten (Endangered, IUCN 3.1) Schwarzfußiltissen erprobt.[236] Finnland entwickelt einen Impfstoff für Marderhunde und Amerikanische Nerze, um in den Pelztierfarmen keine Massenkeulungen vornehmen zu müssen.[237] Auch Russland entwickelt einen Impfstoff für Nerze, Katzen und Nagetiere.[238]
Primaten
Ein Übergang von SARS-CoV-2 vom Menschen auf Menschenaffen wurde erstmals Anfang 2021 nachgewiesen, und zwar bei den Gorillas im San Diego Zoo Safari Park. Laut einer Mitteilung der Zooverwaltung hatten zwei Gorillas am 6. Januar 2021 zu husten begonnen, weswegen Fäkalien der Tiere auf das Virus getestet wurden. Aufgrund der positiven Befunde wurden weitere Tests durch das veterinärmedizinische Labor des U.S. Department of Agriculture durchgeführt, die ebenfalls positive Befunde erbrachten.[239][240][241] Abgesehen vom Husten waren in der Gorilla-Gruppe keine gesundheitlichen Auffälligkeiten zu beobachten.
Weitere Befunde:
- Im Jahr 2016 wurde bei Schimpansen im Tai-Nationalpark (Elfenbeinküste) eine Infektion mit dem Humanen Coronavirus OC43 (HCoV-OC43, ein Betacoronavirus aus der Untergattung Embecovirus, Spezies Betacoronavirus 1)[242] beobachtet, das bei Menschen milde erkältungsartige Symptome hervorruft. Diese zeigten auch die Schimpansen. Um SARS-CoV-2-Übertragungen zu vermeiden, wurde daher im Frühjahr 2020 (insbesondere für Wildhüter) empfohlen, zu den Schimpansen einen Mindestabstand von 7 bis 10 Meter zu halten und auch gegenüber den Tieren gegebenenfalls Quarantänezeiten einzuhalten.[243]
- Eine chinesische Forschergruppe um Chuan Qin stellte im März 2020 vorläufige Ergebnisse ihrer Untersuchungen an Rhesusaffen als Preprint zur Verfügung. Hierbei ging es insbesondere um die Frage der Infektiosität nach überstandener Erkrankung.[244][245][246] Auch eine im Mai 2020 in Science publizierte Studie an Rhesusaffen berichtete von „schützender Immunität“ nach erstmaliger Erkrankung.[247]
- Niederländische Forscher berichteten im März 2020 in Science, dass SARS-CoV-2 bei Javaneraffen eine „COVID-19-ähnliche Krankheit“ verursache, weswegen diese Tiere als Modell für das Testen von vorbeugenden und therapeutischen Strategien geeignet seien.[248]
Weitere Wirbeltiere
Im New Yorker Bronx Zoo wurde Anfang April 2020 ein erwachsener Tiger positiv auf SARS-CoV-2 getestet,[249] nachdem bei ihm trockener Husten und keuchender Atem aufgefallen waren, jedoch keine Atemnot. Weiterhin wiesen auch zwei Löwen und fünf Tiger ähnliche Symptome auf, weswegen auch bei ihnen eine Infektion mit SARS-CoV-2 vermutet wurde. Infiziert wurden die Tiere vermutlich von einem asymptomatischen Bediensteten des Zoos. Wenige Tage nach dem Auftreten von Krankheitszeichen erholten sich die Tiere wieder.[250] Im Joburg Zoo in Johannesburg (Südafrika) infizierte sich im Juli 2020 ein Puma bei einem infizierten Tierbetreuer.[251] Chinesische Forscher berichteten im April 2020 in der Fachzeitschrift Science, dass sich das Virus in Hunden, Schweinen, Hühnern und Enten nur schlecht („poorly“) vermehre, und bestätigten, dass Frettchen und Katzen infiziert werden können.[252] Auch Goldhamster, die nach einer Infektion mit SARS-CoV[-1] nur sehr schwache Symptome entwickelt hatten und daher als Modelltiere ungeeignet waren, ließen sich im Labor mit SARS-CoV-2 infizieren, zeigten deutliche Symptome und wiesen hohe Viruskonzentrationen in Lunge und Darm auf.[253]
Wie bereits oben erwähnt, hatte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aufgrund eigener Tests solche Befunde bestätigt: Nilflughunde sind neben Frettchen (im Gegensatz zu Schweinen und Hühnern) empfänglich für eine SARS-CoV-2-Infektion.[211][235]
Diese Ergebnisse wurden durch eine Studie von Kore Schlottau (WHO) et al. (veröffentlicht im Juli 2020) ein weiteres Mal bestätigt und vertieft. Getestet wurden Nilflughunde (Rousettus aegyptiacus, englisch fruit bats), Frettchen (von den Autoren als Mustela putorius bezeichnet), Hausschweine (Sus scrofa domesticus) und Haushühner (Gallus gallus domesticus). Die Hausschweine und Haushühner erwiesen sich auch hier als nicht empfänglich für SARS-CoV-2. Als die Forscher begannen, Schweine und Ferkel künstlich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, stellten sie fest, dass es sich nicht gut replizierte. Sieben von neun Nilflughunden erkrankten zunächst an Rhinitis, das Virus wanderte mit weiterem Fortschreiten der Erkrankung über die Luftröhre teilweise bis in die Lunge. Bei den Frettchen wurde zwar eine noch effizientere Virusreplikation, aber bis auf eine mögliche leichte Rhinitis keine Krankheitssymptome beobachtet. Sie entwickelten wie auch die Nilflughunde Antikörper gegen SARS-CoV-2.[254]
Laut einer Studie des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zeigen Rinder eine geringe Empfänglichkeit gegenüber SARS-CoV-2.[255]
Während im Labor infizierte Mäuse offenbar keine Krankheitssymptome entwickeln, war es Y.-C. Wang und Kollegen in China möglich, bei C57BL / 6-Labormäusen mit CRISPR / Cas9 das ACE2 der Mäuse (mACE2, murines ACE2) durch das des Menschen (hACE2, humanes ACE2) zu ersetzen. Die hACE2-Mäuse zeigten Virusreplikation von SARS-CoV-2 in ihren Lungen, der Luftröhre und im Gehirn. Auch der Verdauungstrakt war betroffen, so wie es bei manchen menschlichen Patienten beobachtet wird. Sie scheinen damit geeignet, um etwa einen Impfstoff zu testen, bevor er Menschen verabreicht wird;[256][257] eine Alternative zur Methode die Wirkung eines Mittels auf künstlich mutierte Sarbecoviren zu testen, wie jüngst bei Remdesivir und SARS-CoV-RdRp / SARS-CoV-2-RdRp (altes SARS-Virus mit RdRP-Gen von SARS-CoV-2) geschehen.[258][259]
Risikogruppe nach Biostoffverordnung
Für Beschäftigte, die durch ihre berufliche Tätigkeit mit Infektionserregern in Kontakt kommen können, gilt in Deutschland die Biostoffverordnung (BioStoffV). Der bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) eingerichtete Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) hat SARS-CoV-2 am 19. Februar 2020 vorläufig in die Risikogruppe 3 nach der BioStoffV eingeordnet (zweithöchste Stufe).[260] Grundsätzlich erfolgt die Einstufung in Risikogruppen in den Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe (TRBA), die von der BAuA veröffentlicht werden, für Viren ist dies die TRBA 462: Einstufung von Viren in Risikogruppen. Beim Auftreten neuartiger, noch nicht zugeordneter Krankheitserreger erfolgt zunächst eine vorläufige Einstufung durch den ABAS. In der Begründung wird auf die Ähnlichkeit von SARS-CoV-2 mit dem SARS-CoV-1 hingewiesen, der die SARS-Pandemie 2002/2003 ausgelöst hat, und auch die Ähnlichkeit in geringerem Umfang mit dem MERS-CoV wird erwähnt. Diese beiden Viren wurden ebenfalls der Risikogruppe 3 zugeordnet. Der ABAS nennt die „derzeit fehlenden Möglichkeiten zu Impfprävention und Therapie sowie die große Verbreitungsmöglichkeit in der Bevölkerung“ als Begründung für die vorläufige Zuordnung zur Risikogruppe 3.[261]
Außerdem werden Empfehlungen zur Arbeit mit dem Virus bei der Diagnostik im Labor gegeben: Nicht gezielte Tätigkeiten (vergleiche § 5 BioStoffV) – ausgehend vom Untersuchungsmaterial, also beispielsweise die Probenvorbereitung, Probenaufbereitung und die Inaktivierung, um den Nachweis mittels RT-PCR (siehe Abschnitt Nachweismethoden) durchzuführen – können unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 durchgeführt werden. Dabei sind alle Tätigkeiten, bei denen mit Aerosolbildung zu rechnen ist, in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank der Klasse II durchzuführen. Außerdem ist die entsprechende persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Gezielte Tätigkeiten nach § 5 BioStoffV dürfen nur in Laboratorien der Schutzstufe 3 durchgeführt werden, dies betrifft z. B. die Vermehrung des Virus in einer Zellkultur.[261] Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC hatte zuvor ähnliche Empfehlungen herausgegeben.[262]
Klinische Erscheinungen
| Klassifikation nach ICD-10 | |
|---|---|
| U07.1 | COVID-19, Virus nachgewiesen |
| U07.2 | COVID-19, Virus nicht nachgewiesen |
| ICD-10 online (WHO-Version 2019) | |
Nachweismethoden
RT-PCR-Test
Der sogenannte „PCR-Test“ (genauer: real-time quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion) gilt als Goldstandard für den Nachweis von SARS-CoV-2, da er besonders sensitiv und wenig fehleranfällig ist. Er wird von geschultem Personal in der Regel per Rachenabstrich durchgeführt und im Labor innerhalb weniger Stunden bis Tage ausgewertet.[263]
Antigen-Schnelltest
Mit einem Schnelltest können innerhalb von knapp 15 Minuten Antigene von SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Er wird durch einen Nasenabstrich oder über eine Speichelprobe mittels eines Lateral-Flow-Tests durchgeführt. Der Antigen-Schnelltest ist nicht so sensitiv wie ein PCR-Test und damit weniger aussagekräftig. Durch das schnellere Ergebnis, die geringeren Kosten und weil er als „Selbsttest“ auch von Laien durchgeführt werden kann, kam ihm in der COVID-19-Pandemie dennoch eine wichtige Rolle zu. Ein positives Testergebnis (angezeigt durch einen – auch nur leicht sichtbaren – zweiten Streifen auf dem Testkit) sollte aber immer durch einen PCR-Test abgesichert werden.[264]
Antikörpernachweis

Während die beiden obengenannten Verfahren eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisen können, wird eine mögliche Immunität durch den Test auf Antikörper überprüft. Dieser erfolgt durch eine Blutprobe, welche ebenfalls mittels eines Schnelltests untersucht werden kann.
Vorgehensweise beim Nachweis
Behandlung
Für die Krankheit COVID-19 gibt es bisher keine spezifische Behandlung, eine Therapie zielt darauf ab, die Symptome zu lindern. Es wird jedoch untersucht, ob bereits bekannte Virostatika auch bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 wirksam sind.
Vorbeugung
Impfstoffe / Impfung gegen COVID-19
Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung der RNA-Sequenz des Virus wurde in mehreren Laboren mit der Impfstoffentwicklung begonnen.[265][266] Die internationale Impfstoffinitiative CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) plante, bis Mitte Juni 2020 erste Tests mit bis dahin entwickelten Impfstoffen durchzuführen. Dafür erhielten mehrere potentiell geeignete Unternehmen finanzielle Unterstützung.[267] In Deutschland betraf dies u. a. die Tübinger Biotechnologiefirma Curevac, die zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut an der schnellen Impfstoffentwicklung arbeitete.[268][269]
Bei oder nach der Klinischen Prüfung der Arzneimittelstudie (Phase-III-Studie) sind unter anderem die RNA-Impfstoffe Tozinameran (BioNTech / Pfizer) und mRNA-1273 (Moderna) sowie die Vektorimpfstoffe: Vaxzevria, zuvor AZD1222, (AstraZeneca / Oxford) und Ad26.COV2.S (Janssen / Johnson & Johnson) zugelassen worden. Weltweit werden 278 Impfprojekte vorangetrieben (Stand: 26.03.2021). Es wird bei der Impfung unterschieden zwischen Lebendimpfstoffen mit Vektorviren, die mit Oberflächenproteinen von SARS-CoV-2 ergänzt wurden und die so abgeschwächt sind, dass sie keine krankmachenden Eigenschaften mehr besitzen, Totimpfstoffen mit Virusproteinen, die die Kaskade der Immunantwort in Gang bringen und RNA-Impfstoffen mit ausgewähltem Gen des Virus in Form von RNA.[270][271]
Um den anfänglich knappen Impfstoff einer gerechten Verteilung zuzuführen, wurde für Deutschland ein gemeinsames Positionspapier zur Priorisierung der COVID-19-Impfmaßnahmen durch die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut, den Deutschen Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina entwickelt. RKI-Chef Lothar Wieler sagte: Bis man aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten könne, müsse der Anteil der immunen Menschen in der Bevölkerung deutlich über 80 Prozent liegen.[272][273]
Durch eine Impfung kann es allerdings dazu kommen, dass nicht-neutralisierende Antikörper entwickelt werden, die eventuell sogar die Infektion der Makrophagen erleichtern und damit die Infektion verschlimmern. Dies wurde beispielsweise bei der Impfung von Katzen gegen Felines Coronavirus beobachtet;[274] dort tritt diese Infektionsverstärkung nicht nur aufgrund einer Impfung, sondern auch aufgrund einer vorher durchgemachten Erkrankung mit dem Virus auf.[275] → Siehe auch: Infektionsverstärkende Antikörper
Impfung gegen andere Infektionen
Die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung empfahl Ende Februar 2020 allen Menschen über 60 Jahre und chronisch Kranken, ihren Impfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls die Impfung gegen Pneumokokken (Impfstoffe wie Pneumovax 23 waren jedoch im März 2020 nur noch eingeschränkt lieferbar[276]) und Keuchhusten (Pertussis) durchführen oder auffrischen zu lassen. Da Menschen über 60 Jahren und chronisch Kranke durch SARS-CoV besonders gefährdet sind, seien sie vorsorglich zu schützen.[277][278]
Hygienemaßnahmen
Die wichtigsten dieser Maßnahmen sind:
- Persönliche Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, mindestens 20 Sekunden lang)
- Augen, Nase oder Mund nicht mit ungewaschenen Händen berühren
- Einhalten des Mindestabstands (1,5 bis 2 Meter) zu anderen Personen außer solchen desselben Haushalts
- Husten oder Niesen nur in Taschentuch oder Armbeuge, keinesfalls in die Hand
- Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (partikelfilternde Halbmaske, FFP2) in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden, insbesondere Spitälern, Heimen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, sowie im Freien, wenn nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann
- Geschlossene Räume ausreichend und häufig lüften
- Die Raumluftqualität kann hierzu mit Hilfe von Kohlenstoffdioxidmessungen überwacht werden, wie zum Beispiel mit CO2-Ampeln.
- Die Raumluft kann mit Schwebstofffiltern gereinigt werden, um Viren zu entfernen.
- Bei Krankheitsgefühl statt Arztbesuch das Info-Telefon anrufen und zu Hause bleiben
- Eine der neu entwickelten Corona-Apps am Handy installieren.
Epidemische Lage
SARS-CoV-2 verursacht die Erkrankung COVID-19 (für englisch corona virus disease 2019), die im Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei auffällig wurde, sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur Epidemie entwickelte und sich dann weltweit als COVID-19-Pandemie ausbreitete. Um einer Ausbreitung in Staaten ohne leistungsfähige Gesundheitssysteme entgegenzuwirken, rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30. Januar 2020 die Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite (internationale Gesundheitsnotlage) aus.[279] Am 11. März 2020 stufte die WHO die bisherige Epidemie zu einer Pandemie hoch.[280] Nach einer entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hat der Deutsche Bundestag mit Wirkung zum 28. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite von unbestimmter Dauer festgestellt.
Meldepflicht
In Deutschland ist der direkte und indirekte Nachweis von SARS-CoV-2 seit dem 23. Mai 2020 gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) für Labore namentlich meldepflichtig, sofern der Nachweis auf eine akute Infektion hindeutet. Die Meldepflicht wurde bereits zum 1. Februar 2020 durch Verordnung eingeführt. Seit der gesetzlichen Regelung durch das Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im IfSG war auch das Untersuchungsergebnis (einschließlich negativer Testergebnisse[281][282]) nichtnamentlich durch Labore zu melden (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 IfSG alter Fassung). Diese nichtnamentliche Meldepflicht für Untersuchungsergebnisse (und damit für negative Testergebnisse) war jedoch ausgesetzt, solange das Robert Koch-Institut noch nicht über das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) verfügte.[283] Seit dem 19. November 2020 ist diese Meldepflicht aufgehoben.[284] Allerdings besteht für Ärzte noch eine Meldepflicht hinsichtlich der durch das Virus verursachten Atemwegserkrankung COVID-19 in Bezug auf Menschen. Seit dem 2. Juli 2020 besteht eine Meldepflicht, wenn Haustiere positiv getestet wurden.[285]
In Österreich besteht ebenfalls Anzeigepflicht, und zwar nach dem Epidemiegesetz 1950[286] zusammen mit einer Verordnung.[287] Die Pflicht zur Anzeige besteht für Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle aufgrund dieses Virus. Zudem wurde auch die Absonderungsverordnung[288] um das neue Coronavirus erweitert.[289]
Auch in der Schweiz existiert eine Meldepflicht.[290] Diese folgt aus dem Epidemiengesetz[291] der Schweiz in Verbindung mit der Epidemienverordnung[292] und der Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen[293] Nach Anhang 1 der Verordnung des EDI müssen Ärzte einen klinischen Verdacht und die Veranlassung einer erregerspezifischen Labordiagnostik und den nötigen epidemiologischen Zusammenhang melden. Nach Anhang 3 der Verordnung des EDI müssen Labore einen positiven und negativen Befund (also Nachweis) melden. Das Bundesamt für Gesundheit hat hierzu Verdachts-, Beprobungs-, Meldekriterien veröffentlicht.[294]
Weblinks
- Nextstrain – Datenbank der genetischen Varianten von SARS-CoV-2
Von Behörden in Deutschland
- SARS-CoV-2: Virologische Basisdaten sowie Virusvarianten. (Stand: 23. Dezember 2020). In: Website des Robert Koch-Instituts (RKI). RKI, 23. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020.
- COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2). Übersichtsseite des Robert Koch-Instituts (RKI). In: rki.de. Robert Koch-Institut, 9. Oktober 2020 (wird laufend aktualisiert).
- Berichte zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7. In: RKI-Website zum Coronavirus SARS-CoV-2. Robert Koch-Instituts (RKI), abgerufen am 12. Mai 2021.
- Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2. In: rki.de. Robert Koch-Institut, 18. März 2021 (wird laufend aktualisiert).
- Informationen zu unterschiedlichen Typen des Coronavirus SARS-CoV-2 / Beiträge und Studien zu Typisierung, Klassifikation und Mutation. (PDF). In: Dokumentation WD 9 - 3000 - 063/20. Hrsg.: Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste (WD 9: Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und Jugend), 22. September 2020, abgerufen am 1. Juni 2021 („Zur Einordnung der diversen Typen des Virus wurden unterschiedliche Nomenklaturen eingeführt. Dabei basieren zwei der drei wichtigsten Nomenklaturen, verwendet von GISAID9 und Nextstrain10, auf der Einordnung in sog. „Kladen“(englisch: „clades“)11. Diese sollen einen breit gefassten Ansatz für die global zirkulierende Diversität des Virus liefern. Die Zuordnung erfolgt anhand der vorhandenen Mutationen der jeweils untersuchten Virussequenzen.“ → Quelle: ebenda, S.5).
Von Behörden in Österreich
- Neuartiges Coronavirus (COVID-19). In: sozialministerium.at, Infektionskrankheiten A-Z. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Österreich), 9. Oktober 2020 (wird laufend aktualisiert).
- Informationen zum Coronavirus. In: sozialministerium.at. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Österreich), 9. Oktober 2020 (wird laufend aktualisiert).
Von Behörden in der Schweiz
- Neues Coronavirus. In: bag.admin.ch. Bundesamt für Gesundheit (Schweiz), 9. Oktober 2020 (wird laufend aktualisiert).
Von internationalen Organisationen
- Weltgesundheitsorganisation: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. In: who.int. (englisch, wird laufend aktualisiert).
Von anderen Anbietern
- Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Herausforderungen und Interventionsmöglichkeiten. (PDF; 158 kB) Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 21. März 2020.
- Ewen Callaway: The coronavirus is mutating – does it matter? In: Nature – a weekly journal of science. Natur – About the Journal, 16. September 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020 (englisch, doi:10.1038/d41586-020-02544-6).
- Corona in 3D: Ein Blick ins Innere des Virus. (Interaktive 3D-Animation, Quelle: dpa, AFP, Reuters, ZDF). In: ZDFheute. 8. April 2021, abgerufen am 17. April 2021 (Bekanntes und weniger Bekanntes über das neuartige Coronavirus).
- SARS-CoV-2-Varianten: Evolution im Zeitraffer. In: aerzteblatt.de (Dtsch Arztebl 2021; 118(9): A-460 / B-388). Hrsg.: Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung, abgerufen am 14. Mai 2021.
- Beweglicher als gedacht – neue Erkenntnisse über das Spikeprotein von SARS-CoV-2. In: PEI-Pressemitteilung 14 / 2020. Paul-Ehrlich-Institut (PEI), 18. August 2020, abgerufen am 14. Mai 2021 (Videoimulation von vier Spike-Proteinen des SARS-CoV-2-Virus vom Max-Planck-Institut für Biophysik).
- Coronavirus-Mutationen: WHO benennt Corona-Varianten um. In: Forschung und Lehre (Zeitschrift) – Online. Hrsg.: Deutscher Hochschulverband, 1. Juni 2021, abgerufen am 1. Juni 2021 („Die Benennung von Coronavirus-Mutanten erfolgt nach verschiedenen Nomenklaturen. Die WHO führt eine neue ein, um Herkunftsverweise zu vermeiden.“).
Anmerkungen
- ↑ In dieser Übersicht (Infobox Virus) wurde das Virus mit dem Namen „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2“ bzw. „SARS-CoV-2“ vereinfachend als Unterart bzw. Subspezies eingeordnet. Die zuständige Institution, das Internationale Komitee für die Taxonomie von Viren (ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses), welches sich mit der offiziellen Einteilung und Benennung von Viren beschäftigt, definiert die „species“ (also die „Virusart“ oder die „Spezies“) als kleinste verwendbare Einheit (Taxon) für diese Einteilung. Die zuständige Arbeitsgruppe für die Coronaviridae, CSG („Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses“), verwendet den Begriff Klade bzw. „Schwesterklade“ („sister clade“) für die Zuordnung von „SARS-CoV-2“ gegenüber anderen Viren innerhalb derselben Spezies, Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (CSG, Gorbalenya et al., 2020; https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z ).
Einzelnachweise
- ↑ Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAM: ID#: 23312. In: Centers for Disease Control and Prevention (Hrsg.): Public Health Image Library (PHIL). 2020, abgerufen am 26. Februar 2020.
- ↑ a b c d e f g h i j ICTV: ICTV Taxonomy history: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, EC 51, Berlin, Juli 2019; Email ratification March 2020 (MSL #35)
- ↑ a b Coronaviridae Study Group of the International Committee on Taxonomy of Viruses., Gorbalenya, A.E., Baker, S.C. et al.: The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. In: Nature Microbiology. Band 5, Nr. 4, April 2020, ISSN 2058-5276, S. 536–544, doi:10.1038/s41564-020-0695-z, PMID 32123347, PMC 7095448 (freier Volltext) – (nature.com).
- ↑ a b c d Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 → Erreger. (Stand: 11. Dezember 2020). In: Website des Robert Koch-Instituts: COVID-19 in Deutschland. Robert Koch-Institut, 11. Dezember 2020, abgerufen am 6. Januar 2021.
- ↑ a b c Lucy van Dorp, Mislav Acman, Damien Richard, Liam P. Shaw, Charlotte E. Ford: Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2. In: Infection, Genetics and Evolution. Band 83, September 2020, S. 104351, doi:10.1016/j.meegid.2020.104351, PMID 32387564, PMC 7199730 (freier Volltext).
- ↑ a b Pneumonia of unknown cause – China. Disease Outbreak News (DONs) – WHO, 5. Januar 2020, abgerufen am 29. April 2020.
- ↑ Florian Rötzer: WHO ruft international Notlage aus 30. Januar 2020.
- ↑ Coronavirus SARS-CoV-2: Risikobewertung zu COVID-19. „Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 wurde am 11.03.2020 von der WHO zu einer Pandemie erklärt.“ In: Website des RKI. Robert Koch-Institut (RKI), 26. Mai 2020, abgerufen am 26. Mai 2020.
- ↑ The Size of SARS-CoV-2 Compared to Other Things. 16. Juli 2020, abgerufen am 31. Dezember 2020.
- ↑ Neue Erkenntnisse über Superspreader-Ereignisse – Eine Zusammenfassung aktueller Studien von Klaus Taschwer. Abgerufen am 26. Mai 2020.
- ↑ Covid-19: Welche Rolle spielen „Superspreader“ bei der Ausbreitung des Coronavirus? Deutschlandfunk–Online, 28. Mai 2020, abgerufen am 28. Mai 2020.
- ↑ a b Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19. (Stand 9. Januar 2021). In: Website des Robert Koch-Instituts. Robert Koch-Institut, 8. Januar 2020, abgerufen am 14. Januar 2021 (Abschnitt: Neuartige Virusvarianten, Abs. 2).
- ↑ Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Stand: 23. Dezember 2020, Abschnitt: Molekulare Surveillance, Abs. (9). In: Website des Robert Koch-Instituts: COVID-19 in Deutschland. Robert Koch-Institut, 23. Dezember 2020, abgerufen am 14. Januar 2021.
- ↑ Stephanie Hegarty: The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus. BBC News, 6. Februar 2020, abgerufen am 6. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Deutsche Welle (www.dw.com): Whistleblower-Arzt aus Wuhan gestorben | DW | 07.02.2020. Abgerufen am 12. Mai 2020.
- ↑ a b Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu, Peihua Niu, Faxian Zhan, Xuejun Ma, Dayan Wang, Wenbo Xu, Guizhen Wu, George F. Gao, Wenjie Tan for the China Novel Coronavirus Investigating and Research Team: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. In: The New England Journal of Medicine. 24. Januar 2020, doi:10.1056/NEJMoa2001017 (englisch).
- ↑ Pneumonia of unknown cause – China. In: Website der WHO. 5. Januar 2020, abgerufen am 14. Januar 2020 (englisch).
- ↑ New virus surging in Asia rattles scientists. In: nature.com. 20. Januar 2020, abgerufen am 28. Januar 2020 (englisch).
- ↑ Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally. In: ScienceMag des AAAS. 26. Januar 2020, abgerufen am 23. April 2020 (englisch).
- ↑ Chaolin Huang et al.: Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, in: The Lancet Band 395, Nr. 10223 vom 15. February 2020, S. 497–506, veröffentlicht am 24. Januar 2020, doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5
- ↑ WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China. WHO, 9. Januar 2020, abgerufen am 14. Januar 2020 (englisch).
- ↑ Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus SARS-CoV-2. In: Website des Robert Koch-Instituts. 18. März 2020, abgerufen am 19. März 2020.
- ↑ a b c F. Wu, S. Zhao, B. Yu, Y.-M. Chen, W. Wang, Y. Hu, Z.-G. Song, Z.-W. Tao, J.-H. Tian, Y.-Y. Pei, M. L. Yuan, Y.-L. Zhang, F.-H. Dai, Y. Liu, Q.-M. Wang, J.-J. Zheng, L. Xu, E. C. Holmes, Y.-Z. Zhang: Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. In: Website Nucleotide des National Center for Biotechnology Information (NCBI). Abgerufen am 4. Februar 2020.
- ↑ WHO: Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases. Auf: who.int vom 14. Januar 2020.
- ↑ Karola Neubert: Erster Test für das neuartige Coronavirus in China ist entwickelt. In: Website Informationsdienst Wissenschaft (idw). 16. Januar 2020, abgerufen am 9. Februar 2020.
- ↑ Victor M. Corman et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. In: Eurosurveillance. Band 25, Nr. 3, 23. Januar 2020, ISSN 1560-7917, S. 2000045, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045, PMID 31992387, PMC 6988269 (freier Volltext) – (eurosurveillance.org [abgerufen am 28. Dezember 2020]).
- ↑ a b Unlocking the Genetic Code of the Novel Coronavirus: How COVID-19 Made the Leap From Animals to Humans, auf SciTechDaily vom 26. März 2020, Quelle: University of Sydney
- ↑ a b c d e f g h i j k l Alexandre Hassanin: Coronavirus Could Be a ‘Chimera’ of Two Different Viruses, Genome Analysis Suggests, auf: sciencealert vom 24. März 2020 (Quelle: The Conversation)
- ↑ Lucy van Dorp et al.: Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2. 5. Mai 2020 doi:10.1016/j.meegid.2020.104351 , frei zugänglicher Volltext unter: gleicher Artikel in NCBI-NIH-Artikel-Datenbank
- ↑ https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wissen/woher-kommt-das-corona-virus-e946600/
- ↑ Aylin Woodward: The Chinese CDC now says the coronavirus didn't jump to people at the Wuhan wet market — instead, it was the site of a superspreader event, auf Business Insider vom 29. Mai 2020
- ↑ Sudhir Kumar et al.: An evolutionary portrait of the progenitor SARS-CoV-2 and its dominant offshoots in COVID-19 pandemic, auf: bioRxiv vom 29. September 2020, doi:10.1101/2020.09.24.311845 (Preprint), dazu:
Joseph Caspermeyer: COVID-19 Patient Zero: Data Analysis Identifies the “Mother” of All SARS-CoV-2 Genomes, auf: SciTechDaily vom 7. November 2020 - ↑ Quelle: t-online, Euronews World News, cnn. com, Nachrichtenagentur AFP: WHO Wuhan mission find possible signs of wider original outbreak in 2019.
- ↑ a b Bislang ältester Nachweis einer Corona-Infektion könnte aus Italien stammen. In: Der Spiegel. 11. Januar 2021, abgerufen am 12. Januar 2021 (Die Mitteilung bezieht sich auf einen „Research Letter“ (Kurzmitteilung): „COVID-19 related dermatosis in November 2019. Could this case be Italy’s patient zero?“, veröffentlicht im British Journal of Dermatology).
- ↑ Hanno Charisius: Zirkulierte das Coronavirus bereits im November 2019? In: Süddeutsche Zeitung. 12. Januar 2021, abgerufen am 16. Februar 2021.
- ↑ Corona war schon im September 2019 da, auch in Europa. In: Website–Deutsche Welle. 20. November 2020, abgerufen am 14. Februar 2021 (Die Mitteilung bezieht sich auf die Studie: „Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy“, veröffentlicht von SAGE Publications am 11. November 2020).
- ↑ Text der Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen Coronavirus („2019-nCoV“)
- ↑ Neues Coronavirus. In: bag.admin.ch. Bundesamt für Gesundheit BAG, 13. März 2020, abgerufen am 15. März 2020 (Schweizer Hochdeutsch).
- ↑ Fast 100 weitere Tote durch Covid-19 in China. Süddeutsche Zeitung, 12. Februar 2020, abgerufen am 13. Februar 2020 (Direkt aus dem dpa-Newskanal).
- ↑ Novel Coronavirus (2019-nCoV). (Memento vom 28. Januar 2020 im Internet Archive)
- ↑ Taxonomy ID: 2697049 Wuhan seafood market pneumonia virus. (Memento vom 3. Februar 2020 im Internet Archive)
- ↑ Ching-Tse Cheng: WHO declines to name new pneumonia after 'China' or 'Wuhan'. Taiwan News, 14. Januar 2020, abgerufen am 14. Januar 2020 (englisch).
- ↑ WHO issues best practices for naming new human infectious diseases. Weltgesundheitsorganisation, 8. Mai 2015, abgerufen am 6. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Taxonomy Browser: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Taxonomy ID: 2697049 (Memento vom 22. Februar 2020 im Internet Archive) Im Original veröffentlicht vom National Center for Biotechnology Information (NCBI).
- ↑ Nicky Phillips, Smriti Mallapaty, David Cyranoski: How quickly does the Wuhan virus spread? In: Nature. 21. Januar 2020, doi:10.1038/d41586-020-00146-w (englisch).
- ↑ Novel Coronavirus (2019-nCoV). (PDF; 1,0 MB) Situation Report – 22. WHO, 11. Februar 2020, abgerufen am 13. Februar 2020.
- ↑ a b Lars Fischer, Alina Schadwinkel: Verursacht das Coronavirus Engpässe bei Medikamenten? Stammt das Virus aus dem Pangolin? Website Spektrum.de, 10. Februar 2020, abgerufen am 15. Februar 2020.
- ↑ a b Alexander E. Gorbalenya, Susan C. Baker, Ralph S. Baric, Raoul J. de Groot, Christian Drosten, Anastasia A. Gulyaeva, Bart L. Haagmans, Chris Lauber, Andrey M Leontovich, Benjamin W. Neuman, Dmitry Penzar, Stanley Perlman, Leo L.M. Poon, Dmitry Samborskiy, Igor A. Sidorov, Isabel Sola, John Ziebuhr: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group. In: bioRxiv. 11. Februar 2020, bioRxiv: 10.1101/2020.02.07.937862v1 (Preprint-Volltext), S. 1–20, doi:10.1101/2020.02.07.937862 (englisch).
- ↑ Shibo Jiang, Zhengli Shi, Yuelong Shu, Jingdong Song, George F. Gao, Wenjie Tan, Deyin Guo: A distinct name is needed for the new coronavirus. In: The Lancet. 19. Februar 2020, doi:10.1016/S0140-6736(20)30419-0 (englisch).
- ↑ a b c d Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes, Robert F. Garry: The Proximal Origin of SARS-CoV-2. In: virological.org, Quelle: ARTIC Network, 17. Februar 2020, Nature
- ↑ Ewen Callaway: Corona-Mutationen: Neue Namen für das Virus, auf: spektrum.de vom 18. Januar 2021
- ↑ a b Ben Hu, Lei-Ping Zeng, Xing-Lou Yang, Xing-Yi Ge, Wei Zhang et al.: Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus. In: PLOS Pathogens, 30. November 2017, doi:10.1371/journal.ppat.1006698
- ↑ ICTV Master Species List 2018b.v2. MSL #34, März 2019
- ↑ a b c d e NCBI Database Nucleotide, txid2697049 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). In: Website Nucleotide des National Center for Biotechnology Information (NCBI). Abgerufen am 16. Februar 2020.
- ↑ Matthew Frieman, Ralph Baric: Mechanisms of severe acute respiratory syndrome pathogenesis and innate immunomodulation. In: Microbiology and Molecular Microbiology Reviews. Band 72, Dezember 2008, S. 672–685, doi:10.1128/MMBR.00015-08, PMID 19052324 (englisch, open access).
- ↑ Peter Dockrill: Scientists Just Found a Mysteriously Hidden 'Gene Within a Gene' in SARS-CoV-2, auf: sciencealert vom 11. November 2020. Quelle: sLife.
- ↑ Wuhan seafood market pneumonia virus. In: Website Genome des National Center for Biotechnology Information (NCBI). Abgerufen am 16. Februar 2020.
- ↑ a b c d Jasper Fuk-Woo Chan, Shuofeng Yuan, Kin-Hang Kok, Kelvin Kai-Wang To, Hin Chu, Jin Yang, Fanfan Xing, Jieling Liu, Cyril Chik-Yan Yip, Rosana Wing-Shan Poon, Hoi-Wah Tsoi, Simon Kam-Fai Lo, Kwok-Hung Chan, Vincent Kwok-Man Poon, Wan-Mui Chan, Jonathan Daniel Ip, Jian-Piao Cai, Vincent Chi-Chung Cheng, Honglin Chen, Christopher Kim-Ming Hui, Kwok-Yung Yuen: A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. In: The Lancet. 24. Januar 2020, doi:10.1016/S0140-6736(20)30154-9 (englisch).
- ↑ a b c d Hufeisennasenfledermäuse. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Oberursel vom 16. Dezember 2015
- ↑ a b Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang, Hui-Dong Chen, Jing Chen, Yun Luo, Hua Guo, Ren-Di Jiang, Mei-Qin Liu, Ying Chen, Xu-Rui Shen, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Kai Zhao, Quan-Jiao Chen, Fei Deng, Lin-Lin Liu, Bing Yan, Fa-Xian Zhan, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Zheng-Li Shi: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. In: Nature. 3. Februar 2020, doi:10.1038/s41586-020-2012-7 (englisch, dieser Artikel wurde am 23. Januar 2020 vorab ohne Peer-Review auf bioRxiv veröffentlicht).
- ↑ D. Paraskevis et al.: Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event. In: bioRxiv. 27. Januar 2020, doi:10.1101/2020.01.26.920249 (englisch).
- ↑ a b c d e Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu, Yuhai Bi, Xuejun Ma, Faxian Zhan, Liang Wang, Tao Hu, Hong Zhou, Zhenhong Hu, Weimin Zhou, Li Zhao, Jing Chen, Yao Meng, Ji Wang, Yang Lin, Jianying Yuan, Zhihao Xie, Jinmin Ma, William J Liu, Dayan Wang, Wenbo Xu, Edward C Holmes, George F Gao, Guizhen Wu, Weijun Chen, Weifeng Shi, Wenjie Tan: Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. In: The Lancet. 29. Januar 2020, doi:10.1016/S0140-6736(20)30251-8 (englisch).
- ↑ Genom-Analysen klären Herkunft von 2019-nCoV. In: Website Deutsches Ärzteblatt. 30. Januar 2020, abgerufen am 9. Februar 2020.
- ↑ 2019-nCoV: Erste Bilder vom Virus und Erkenntnisse zum klinischen Verlauf. In: Website Deutsches Ärzteblatt. 27. Januar 2020, abgerufen am 11. Februar 2020.
- ↑ Pinpointing the 'silent' mutations that gave the coronavirus an evolutionary edge, auf: ScienceDaily vom 16. Oktober 2020
- ↑ SARS-CoV-2: Virologische Basisdaten sowie Virusvarianten. (Stand: 12. Mai2021). In: RKI-Website zum Coronavirus SARS-CoV-2. Robert Koch-Institut (RKI), 12. Mai 2021, abgerufen am 12. Mai 2021.
- ↑ https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-8274-2241-5_14.pdf
- ↑ Qiu, Y. et al.:„Predicting the Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) Utilizing Capability as the Receptor of SARS-CoV-2“. Preprints 2020, 2020030091 (doi: 10.20944/preprints202003.0091.v1)
- ↑ Christian JA Sigrist, Alan Bridge, Philippe Le Mercier: A potential role for integrins in host cell entry by SARS-CoV-2. In: Antiviral Research. Band 177, Mai 2020, S. 104759, doi:10.1016/j.antiviral.2020.104759 (elsevier.com [abgerufen am 1. Mai 2020]).
- ↑ Hoffmann et al., SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a ClinicallyProven Protease Inhibitor, Cell (2020), https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052
- ↑ Blake Oberfeld, Aditya Achanta, Kendall Carpenter, Pamela Chen, Nicole M. Gilette: SnapShot: COVID-19. In: Cell. Band 181, Nr. 4, Mai 2020, S. 954–954.e1, doi:10.1016/j.cell.2020.04.013, PMC 7190493 (freier Volltext) – (elsevier.com [abgerufen am 15. Mai 2020]).
- ↑ Adedeji, Adeyemi & Severson, William & Jonsson, Colleen & Singh, Kamalendra & Weiss, Susan & Sarafianos, Stefan. (2013). Novel Inhibitors of SARS-CoV Entry acting by Three Distinct Mechanisms.. Journal of virology. 87. 10.1128/JVI.00998-13 .
- ↑ RNA-Viren. Spektrum.de, abgerufen am 9. August 2020.
- ↑ Monique Dubois-Dalcq, Kathryn V. Holmes, Bernard Rentier: Assembly of enveloped RNA viruses - Chapter 7 Assembly of Coronaviridæ. Springer Verlag. 16. April 1984.
- ↑ Alex W.H. Chin et al.: Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. In: The Lancet Microbe. Band 1, Nr. 1, e10, 2020, doi:10.1016/S2666-5247(20)30003-3 (open access). Ob der Faktor Temperatur hemmend auf die neuen Virusvarianten wirkt, bleibt zu überprüfen.
- ↑ Feinstaub ist gefährlicher als gedacht. Paul Scherrer Institut, 19. März 2021, abgerufen am 20. März 2021.
- ↑ M. Schuit et al., Airborne SARS-CoV-2 Is Rapidly Inactivated by Simulated Sunlight. In: The Journal of Infectious Diseases 23 (Juli 2020), S. 564-571; X. Liu, et al., The role of seasonality in the spread of COVID-19 pandemic. In: Environmental Research 195 (2021), Nr. 0013-9351; R.K. Moozipurath, L. Kraft, Implications of monsoon season and UVB radiation for COVID‑19 in India. In: Nature. Scientific Reports 11/1 (2021), S. 2757 ff.
- ↑ Nachfolgender Bericht gibt den Forschungsstand und erste Erklärungsmodelle zum Zusammenwirken der genannten Faktoren wieder: First Report of the WMO Covid-19 Task Team: Review on Meteorological and Air Quality Factors Affecting the Covid-19 Pandemic, in: World Meteorological Organization No. 1262 (2021), hier S. 4-6, 11 f. ISBN 978-92-63-11262-0. online-Version; R.K. Moozipurath, L. Kraft, Implications of monsoon season and UVB radiation for COVID‑19 in India.
- ↑ Hinweise zu Erkennung, Diagnostik und Therapie von COVID-19 Patienten (PDF). Hrsg.: »Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger« (STAKOB) – Geschäftsstelle am Robert Koch-Institut, Stand: 5. Nov. 2020, abgerufen am 27. Nov. 2020.
- ↑ Neeltjevan Doremalen et al.: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 The New England Journal of Medicine, April 2020.
- ↑ Virologe Drosten zu Aerosol-Übertragung – "Im Alltag eher aufs Lüften konzentrieren als auf ständiges Desinfizieren". Abgerufen am 25. Mai 2020.
- ↑ Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe, PNAS, abgerufen am 10. März 2021
- ↑ Corona: Österreich riegelt erstmals ganze Stadt ab # Korrelation oder Kausalität?, Telepolis vom 9. März 2021, abgerufen am 10. März 2021
- ↑ SARS-CoV-2: Virologische Basisdaten sowie Virusvarianten. In: rki.de. Robert Koch Institut, 18. März 2021, abgerufen am 4. April 2021.
- ↑ SARS-CoV-2: Mutationen könnten Ansteckungsfähigkeit weiter erhöhen. In: Ärzteblatt. 6. Mai 2020, abgerufen am 7. Mai 2020.
- ↑ Nadja Podbregar: Wie stark ist das Coronavirus mutiert? In: scinexx. 8. Mai 2020, abgerufen am 9. Mai 2020.
- ↑ WHO : Corona-Varianten erhalten Bezeichnungen nach dem griechischen Alphabet. Deutschlandfunk, 31. Mai 2021, abgerufen am 1. Juni 2021.
- ↑ WHO announces simple, easy-to-say labels for SARS-CoV-2 Variants of Interest and Concern. Weltgesundheitsorganisation (WHO), 31. Mai 2021, abgerufen am 1. Juni 2021 (englisch).
- ↑ Tracking SARS-CoV-2 variants. Weltgesundheitsorganisation (WHO), 31. Mai 2021, abgerufen am 1. Juni 2021 (englisch).
- ↑ Statement der Swiss National COVID-19 Science Task Force bezüglich der neuen SARS-CoV-2 Variante VOC-202012/01 www.sciencetaskforce.ch, 25. Dezember 2020.
- ↑ Jury still out on new Covid-19 mutant. www.itv.com, 15. Dezember 2020.
- ↑ a b Kai Kupferschmidt: U.K. variant puts spotlight on immunocompromised patients’ role in the COVID-19 pandemic. In: Science, 23. Dezember 2020, doi:10.1126/science.abg2911 , dazu:
- Thia Ghose:New Fast-Spreading Coronavirus Strain in The UK: Here’s Everything You Need to Know. sciencealert, 26. Dezember 2020. Quelle: Live Science
- ↑ Großbritannien: Neue Corona-Variante offenbar deutlich ansteckender. www.zeit.de, 19. Dezember 2020
- ↑ Johnson sagt Weihnachten ab: Neue Corona-Mutation in Großbritannien um 70 Prozent ansteckender. In: Der Tagesspiegel. 20. Dezember 2020, abgerufen am 25. Februar 2020.
- ↑ Statement from Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty about new strain of Covid-19, GOV.UK, 19. Dezember 2020. Abgerufen am 20. Dezember 2020.
- ↑ Rapid increase of a SARS-CoV-2 variant with multiple spike protein mutations observed in the United Kingdom. In: European Centre for Disease Prevention and Control. 20. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020 (englisch).
- ↑ Weitere Virus-Mutation in Großbritannien. In: Tagesschau. 23. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020.
- ↑ a b Eric Martz: SARS-CoV-2 spike protein mutations. In: Proteopedia. 22. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020 (englisch).
- ↑ a b Nicholas G. Davies et al.: Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science, 3. März 2020, doi:10.1126/science.abg3055
- ↑ Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7, RKI, 17. März 2021
- ↑ R. Challen, E. Brooks-Pollock, J.M. Read, L. Dyson, K. Tsaneva-Atanasova, L. Danon et al. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ 2021; 372 :n579, doi:10.1136/bmj.n579
- ↑ a b Kai Stoppel: Weitere Corona-Mutation bereitet Sorge, auf n-tv.de vom 14. Januar 2021
- ↑ Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? In: Deutschlandradio. 23. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020.
- ↑ Neue Corona-Mutation entdeckt. In: Tagesschau. 19. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020.
- ↑ Neue Virus-Variante in Großbritannien entdeckt. In: Zeit Online. 23. Dezember 2020, abgerufen am 24. Dezember 2020.
- ↑ Südafrikanische Mutation breitet sich in Teilen Tirols aus. In: Sächsische Zeitung unter Bezug auf dpa, 4. Februar 2021, S. 4.
- ↑ Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland. RKI, Stand: 12. Mai 2021, zuletzt abgerufen am 13. Mai 2021
- ↑ a b c Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland. RKI, Stand: 12. Mai 2021, zuletzt abgerufen am 13. Mai 2021
- ↑ Coronavirus: Wohl höhere Pathogenität bei Delta-Variante. In: Pharmazeutische Zeitung. 5. Juni 2021, abgerufen am 8. Juni 2021 („Die Delta-Variante des Coronavirus (B.1.617.2) ist vermutlich nicht nur deutlich ansteckender, sondern auch pathogener als andere Varianten und führt häufiger zu Hospitalisierungen. Das meldet die englische Gesundheitsbehörde. Offenbar kann die Variante auch Teilimmunisierte infizieren.“ →Quelle: ebenda).
- ↑ Gudrun Heise: The COVID variant from India: What we know so far. Deutsche Welle, 21. April 2021, abgerufen am 11. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland. RKI, Stand: 12. Mai 2021, zuletzt abgerufen am 13. Mai 2021
- ↑ Mehul Suthar et al.: Infection and vaccine-induced neutralizing antibody responses to the SARS-CoV-2 B.1.617.1 variant. bioRxiv. 10 Mai 2021 doi:10.1101/2021.05.09.443299
- ↑ a b RKI – SARS-CoV-2: Virologische Basisdaten sowie Virusvarianten. Abgerufen am 29. Januar 2021.
- ↑ Sarah Otto: Why Are New SARS-CoV-2 Variants Spreading So Dramatically Around The World? sciencealert, 24. Januar 2021.
- ↑ Nachweis in Baden-Württemberg – Mutation aus Südafrika erreicht Deutschland, auf n-tv.de vom 12. Januar 2021
- ↑ Nach Einreise aus Brasilien – Weitere Corona-Variante in Japan gefunden. n-tv.de, 10. Januar 2021.
- ↑ B.1.1.7, B.1.351 und B.1.1.28P.1 – Über die Bedeutung der Corona-Mutanten. n-tv.de, 31. Januar 2021.
- ↑ Erstmals Coronavariante aus Brasilien in Deutschland nachgewiesen. In: Deutsches Ärzteblatt – Online. Hrsg.: Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung, 22. Januar 2021, abgerufen am 5. Februar 2021 (© dpa/aerzteblatt.de).
- ↑ Die Mutanten kommen Deutschland bedrohlich nahe. FAZ.net, 12. Februar 2021.
- ↑ Kombimutante in Deutschland nachgewiesen. spiegel.de, 9. März 2021.
- ↑ Auch Nigeria meldet neue Corona-Variante. n-tv.de, 24. Dezember 2020.
- ↑ Stephanie Pappas: Worrisome California coronavirus variant is tied to large outbreaks. LiveScience, 19. Januar 2021.
- ↑ a b Kai Stoppel: Neue Corona-Varianten in den USA aufgetaucht. n-tv, 25. Februar 2021.
- ↑ Neue Corona-Variante in Finnland entdeckt. n-tv, 19. Februar 2021.
- ↑ Coronavirus: Neue Mutation in New York beunruhigt Wissenschaft. In: Der Spiegel. Abgerufen am 25. Februar 2021.
- ↑ Sharon Otterman und Amanda Rosa: Two variants may account for half of New York City’s virus cases, analysis finds. In: The New York Times. 10. März 2021, abgerufen im Jahr 2021 (englisch).
- ↑ Neue Coronavariante in der Bretagne: RKI bewertet Versagen der PCR-Assays als „gering“. Ärztezeitung, 17. März 2021. Abgerufen am 18. März 2021.
- ↑ Irene Habich: Die wichtigsten Virusmutationen – und welche Impfstoffe gegen sie schützen vom 14. April 2021, abgerufen am 29. April 2021
- ↑ Liveblog: ++ Warnung vor steigenden Inzidenzen im Saarland ++. In: tagesschau.de. 22. Mai 2021, abgerufen im Mai 2021.
- ↑ https://www.deutschlandfunk.de/corona-laut-who-keine-neue-hybrid-variante-in-vietnam.2850.de.html?drn:news_id=1266120, abgerufen am 5. Juni 2021.
- ↑ Coronavirus Variants Have Three Classifications, Precision Vaccinations, 17. März 2021. Abgerufen am 17. März 2021
- ↑ US COVID-19 Cases Caused by Variants, CDC, 16. März 2021.Abgerufen am 17. März 2021
- ↑ SARS-CoV-2 Variants, CDC, 16. März 2021. Abgerufen am 17. März 2021
- ↑ Variants: distribution of cases data. PHE, 2021, abgerufen im Jahr 2021 (englisch).
- ↑ Kirsten Ripper: Covid-19: Neue "bretonische Variante" mit PCR-Test nicht nachweisbar. In: Euronews. 16. März 2021, abgerufen im Jahr 2021.
- ↑ Neue Corona-Variante macht Forschern Sorgen. In: t-online.de. 16. März 2021, abgerufen im Jahr 2021.
- ↑ SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. (PDF) PHE, 22. April 2021, abgerufen im Jahr 2021 (englisch).
- ↑ a b c Xingguang Li, Junjie Zai, Qiang Zhao, Qing Nie, Yi Li, Brian T. Foley, Antoine Chaillon: Evolutionary history, potential intermediate animal host, and cross‐species analyses of SARS‐CoV‐2, in: Journal of Medical Virology, 27. Februar 2020, doi:10.1002/jmv.25731 , PDF, PMID 32104911, reseachGate
- ↑ Xiaolu Tang, Changcheng Wu, Xiang Li, Yuhe Song, Xinmin Yao, Xinkai Wu, Yuange Duan, Hong Zhang, Yirong Wang, Zhaohui Qian, Jie Cui, Jian Lu: On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review (NSR, Oxford Academic), 3. März 2020, nwaa036, doi:10.1093/nsr/nwaa036
- ↑ Wissenschaftler entdecken zwei Hauptuntertypen des neuartigen Coronavirus. People’s Dayly Online, China (deutsch).
- ↑ Jessica Hamzelou: Coronavirus: Are there two strains and is one more deadly? NewScientist, 5. März 2020 (mit Coronavirus ist hier ausschließlich SARS-CoV-2 gemeint – freier Artikel).
- ↑ SARS-CoV-2: Gibt es 2 unterschiedliche Virusstämme? aerzteblatt.de, 9. März 2020.
- ↑ Gibt es zwei Stämme von Sars-CoV-2? n-tv.de, 10. März 2020.
- ↑ Korinna Hennig, Christian Drosten: Coronavirus-Update: „Viren mutieren immer“. Interview auf ndr.de, 6. März 2020.
- ↑ Peter Forster, Lucy Forster, Colin Renfrew, Michael Forster: Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes. PNAS, 8. April 2020, doi:10.1073/pnas.2004999117
- ↑ Genetic Study Identifies Three Variants of SARS-CoV-2 Coronavirus. Sci-News, 9. April 2020.
- ↑ a b Daniele Mercatelli, Federico M. Giorgi: Geographic and Genomic Distribution of SARS-CoV-2 Mutations. In: Front. Microbiol., 22. Juli 2020, doi:10.3389/fmicb.2020.01800 , dazu:
- The six strains of SARS-CoV-2. ScienceDaily, 3. August 2020.
- ↑ Kai Kupferschmidt: Der Stammbaum der Pandemie. Spektrum.de, 18. März 2020 (mit Bezug auf Christian Drosten und Andrew Rambaut).
- ↑ Amanda Woods: Iceland scientists found 40 mutations of the coronavirus, report says. New York Post, 24. März 2020.
- ↑ Bo Elkjær: Forskere har sporet 40 mutationer af coronavirus – alene på Island. www.information.dk (Iceland outlet Information), 24. März 2020, dänisch
- ↑ Vanessa Chalmers: Scientists in Iceland claim they have found Forty mutations of the coronavirus – and admit seven cases can be traced back to ‘a football match in England’. www.dailymail.co.uk (MailOnline), 24. März 2020.
- ↑ Alexander Elliott: Two types of COVID-19 in one individual. www.ruv.is (RÚV news), Island, 24. März 2020.
- ↑ Poppy Askham: Patient Infected With Two Strains of COVID-19 In Iceland. The Reykjavík Grapevine, 24. März 2020.
- ↑ Bette Korber, David D. Montefiori et. al.: Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-2. bioRxiv, 30. April 2020.
- ↑ Bestätigt: Neue Variante „infektiöser“. science.orf.at, 3. Juli 2020.
- ↑ Nadja Podbregar: Eine mutierte Form von SARS-CoV-2 hat die ursprüngliche Variante fast verdrängt. scinexx.de, 3. Juli 2020: D614 versus G614.
- ↑ Bette Korber et al.: Tracking changes in SARS-CoV-2 Spike: evidence that D614G increases infectivity of the COVID-19 virus. In: Cell, 2. Juli 2020, doi:10.1016/j.cell.2020.06.043
- ↑ Mehr „Stacheln“ durch Mutation – Wird das Coronavirus ansteckender? n-tv.de, 15. Juni 2020.
- ↑ Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B.1.1.7. (PDF). 5. Februar 2021, abgerufen am 10. Februar 2021.
- ↑ Joana Damas, Graham M. Hughes, Kathleen C. Keough, Corrie A. Painter, Nicole S. Persky, Marco Corbo, Michael Hiller, Klaus-Peter Koepfli, Andreas R. Pfenning, Huabin Zhao, Diane P. Genereux, Ross Swofford, Katherine S. Pollard, Oliver A. Ryder, Martin T. Nweeia, Kerstin Lindblad-Toh, Emma C. Teeling, Elinor K. Karlsson, Harris A. Lewin; Scott V. Edwards (Hrsg.): Broad host range of SARS-CoV-2 predicted by comparative and structural analysis of ACE2 in vertebrates. In: PNAS vom 21. August 2020, doi:10.1073/pnas.2010146117 .
Many Animal Species Vulnerable to SARS-CoV-2 / COVID-19 According to Genomic Analysis, auf: SciTechDaily vom 23. August 2020, Quelle: University of California – Davis.
Nadja Podbregar: Corona: Welche Tierarten sind anfällig?, auf: scinexx.de vom 24. August 2020. - ↑ Grahem Lawton: Is a dangerous new coronavirus strain circulating in farmed mink? NewScientist, 5./6. November 2020.
- ↑ a b Ewen Callaway, David Cyranoski: Why snakes probably aren’t spreading the new China virus – One genetic analysis suggests reptilian reservoir — but researchers doubt that the coronavirus could have originated in animals other than birds or mammals. In: Nature. 23. Januar 2020, doi:10.1038/d41586-020-00180-8 (englisch).
- ↑ Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, Xingguang Li: Homologous recombination within the spike glycoprotein of the newly identified coronavirus may boost cross‐species transmission from snake to human. In: Journal of Medical Virology. 22. Januar 2020, doi:10.1002/jmv.25682 (englisch).
- ↑ Researchers trace coronavirus outbreak in China to snakes. In: Website EurekAlert! 22. Januar 2020, abgerufen am 26. Januar 2020 (englisch).
- ↑ Coronavirus: How worried should we be? BBC News, 27. Januar 2020, abgerufen am 27. Januar 2020 (englisch).
- ↑ a b c Chengxin Zhang et al.: Protein Structure and Sequence Reanalysis of 2019-nCoV Genome Refutes Snakes as Its Intermediate Host and the Unique Similarity between Its Spike Protein Insertions and HIV-1, in: American Chemical Society: J. Proteome Res. vom 22. März 2020, doi:10.1021/acs.jproteome.0c00129 ; PrePrint, PrePrint Volltext (PDF) vom 8. Februar 2020
- ↑ OSM: Tongguan Town
- ↑ Ge, XY., Wang, N., Zhang, W. et al.: Coexistence of multiple coronaviruses in several bat colonies in an abandoned mineshaft, Virol. Sin. 31, 31–40 (2016) DOI: 10.1007/s12250-016-3713-9
- ↑ Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Zheng-Li Shi et al.: Addendum: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin, in: nature, 17. November 2020, doi:10.1038/s41586-020-2951-z . Nachtrag zum Artikel der Autoren vom Februar 2020
- ↑ a b Smriti Mallapaty: Coronaviren in Japan und Kambodscha eng verwandt mit Pandemievirus, auf: Spektrum.de vom 6. Dezember 2020
- ↑ Shin Murakami, Tomoya Kitamura1, Jin Suzuki, Ryouta Sato, Toshiki Aoi, Marina Fujii, Hiromichi Matsugo, Haruhiko Kamiki, Hiroho Ishida, Akiko Takenaka-Uema, Masayuki Shimojima, Taisuke Horimoto: Detection and Characterization of Bat Sarbecovirus Phylogenetically Related to SARS-CoV-2, Japan, in: Emerging Infectious Diseases Journal, Band 26, Nr. 12, Dezember 2020, ISSN 1080-6059, doi:10.3201/eid2612.203386
- ↑ NCBI: Bat coronavirus RaTG13 (no rank)
- ↑ a b Jose Halloy, Erwan Sallard, José Halloy, Didier Casane, Etienne Decroly, Jacques van Helden: Tracing the origins of SARS-COV-2 in coronavirus phylogenies. In: HAL, 16. Juli 2020, HAL Id: hal-02891455 (Preprint)
- ↑ Supaporn Wacharapluesadee, Chee Wah Tan, Patarapol Maneeorn et al.: Evidence for SARS-CoV-2 related coronaviruses circulating in bats and pangolins in Southeast Asia. In: Nature Communications. Band 12, Artikel-Nr. 972 (2021), doi:10.1038/s41467-021-21240-1 .
- ↑ David Cyranoski: Did pangolins spread the China coronavirus to people? In: Nature. 7. Februar 2020, doi:10.1038/d41586-020-00364-2 (englisch).
- ↑ Mike McRae: Coronaviruses Similar to The COVID-19 One Have Just Been Found in Pangolins, auf sciencealert vom 27. März 2020 (mit „COVID-19“ ist nicht die menschliche Krankheit, sondern es sind allgemein Sarbecoviren gemeint, mit „Coronaviruses“ speziell nur SARS-CoV-2). Die Schuppentiere bzw. Teile derselben waren bei einer Anti-Schmuggel Operation vom chinesischen Zoll beschlagnahmt worden, bei Pan_SL-CoV_GD in der Provinz Guandong, bei Pan_SL-CoV_GX in der Provinz Guangxi.
- ↑ Tommy Tsan-Yuk Lam et al.: Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins, in: Nature vom 26. März 2020, doi:10.1038/s41586-020-2169-0 (Preprint)
- ↑ Pangolins, Not Snakes, May Be Missing Link in Coronavirus Jump From Bats to Humans, auf: SciTechDaily vom 27. März 2020, Quelle: American Chemical Society
- ↑ Tina Hesman Saey: https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-not-human-made-lab-genetic-analysis-nature, auf ScienceNews vom 26. März 2020
- ↑ name="LiX2020-05">Xiaojun Li, Elena E. Giorgi, Manukumar Honnayakanahalli Marichannegowda, Brian Foley, Chuan Xiao, Xiang-Peng Kong, Yue Chen, S. Gnanakaran, Bette Korber, Feng Gao: Emergence of SARS-CoV-2 through recombination and strong purifying selection. In: ScienceAdvances, AAAS, vom 29. Mai 2020, eabb9153, doi:10.1126/sciadv.abb9153
- ↑ Bats, Pangolins and Humans: COVID-19 Virus Likely Emerged From Recombination of Viral Genes Across Different Species, auf: ScitechDaily vom 31. Mai 2020. Zitat: „… the virus’ entire receptor binding motif (RBM), a component that plays a key role in viral entry into host cells, was introduced [into specific bat coronaviruses] through recombination with pangolin coronaviruses.“
- ↑ Evolution of Pandemic Coronavirus Outlines Path From Animals to Humans – Highlights Future Danger, auf: SciTechDaily vom 6. Juni 2020, Quelle: DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER
- ↑ Rachel L. Graham, Ralph S. Baric: Recombination, Reservoirs, and the Modular Spike: Mechanisms of Coronavirus Cross-Species Transmission. In: ASM: Journal of Virology 84 (7), März 2010, S. 3134-3146, doi:10.1128/JVI.01394-09 , PDF
- ↑ David Cyranoski: Virologie: Porträt eines Killers. Online-Ausgabe des Artikels in Spektrum der Wissenschaft Nr. 8, August 2020, S. 40–49.
- ↑ Maciej F. Boni, Philippe Lemey, Xiaowei Jiang, Tommy Tsan-Yuk Lam, Blair W. Perry, Todd A. Castoe, Andrew Rambaut, David L. Robertson: Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic. In: Nature Microbiology, 28. Juli 2020, doi:10.1038/s41564-020-0771-4 ; dazu:
Nadja Podbregar: Den Wurzeln von Sars-CoV-2 auf der Spur. wissenschaft.de, 28. Juli 2020;
Nadja Podbregar: Corona: SARS-CoV-2 gibt es schon seit Jahrzehnten. scinexx.de, 29. Juli 2020;
Erin Garcia de Jesus: Close relatives of the coronavirus may have been in bats for decades. ScienceNews, 28. Juli 2020. - ↑ a b c nature.com, The search for animals harbouring Coronavirus-and why it matter. 591, 26-28 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00531-z , abgerufen am 13. April 2021
- ↑ Siehe das Originalinterview des schweizer online-Magazins Republick.ch mit Christian Drosten.
- ↑ Marderhunde als Zwischenwirt? Drosten bringt neue Virusquelle ins Spiel, auf n-tv.de vom 26. April 2020
- ↑ Der Marderhund als Coronavirus-Schleuder?
- ↑ James D. Cherry, Paul Krogstad: SARS: The First Pandemic of the 21st Century
- ↑ Angela M. Bosco-Lauth, Airn E. Hartwig, Stephanie M. Porter et al.: Experimental infection of domestic dogs and cats with SARS-CoV-2: Pathogenesis, transmission, and response to reexposure in cats. In: PNAS. Online-Vorabveröffentlichung vom 29. September 2020, doi:10.1073/pnas.2013102117 .
- ↑ Q&A on coronaviruses (COVID-19). Abgerufen am 6. März 2020 (englisch).
- ↑ Coronaviren können für Haustiere gefährlich werden. In: Frankfurter Neue Presse. 6. März 2020, abgerufen am 6. März 2020.
- ↑ OIE: Immediate notification. Tai Hang, Islands District, Hong Kong. Auf: oie.int, Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), 29. Februar 2020.
Thomas H. C. Sit, Christopher J. Brackman, Sin Ming Ip et al.: Infection of dogs with SARS-CoV-2. In: Nature. Online-Veröffentlichung vom 14. Mai 2020, doi:10.1038/s41586-020-2334-5 . - ↑ Noah Higgins-Dunn: A dog in Hong Kong tests positive for the coronavirus, WHO officials confirm. In: CNBC. 28. Februar 2020, abgerufen am 29. Februar 2020 (englisch).
- ↑ OIE: Immediate notification. Tai Hang, Islands District, Hong Kong. Auf: oie.int vom 29. Februar 2020.
- ↑ Coronavirus: Nein, Hunde erkranken nicht an Covid-19. In: Der Spiegel – Wissenschaft. Abgerufen am 6. März 2020.
- ↑ OIE: Follow-up report No. 3 (Final report): COVID-19 (SARS-COV-2), Hong Kong. Likely human to animal transmission. Auf: oie.int vom 28. März 2020.
- ↑ OIE: Immediate notification. Pok Fu Lam, Southern District, Hong Kong. Auf: oie.int vom 21. März 2020.
- ↑ OIE: Immediate notification. Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo, Japan. Auf: oie.int vom 25. September 2020.
- ↑ Evidence of Stray Dogs as Possible Origin of COVID-19 Pandemic. Auf: scitechdaily.com vom 14. April 2020, Quelle: University of Ottawa.
- ↑ Xuhua Xia: Extreme genomic CpG deficiency in SARS-CoV-2 and evasion of host antiviral defense. In: Molecular Biologa and Evolution. Band 37, Nr. 9, 2020, S. 2699–2705, doi:10.1093/molbev/msaa094 .
- ↑ Angela M. Bosco-Lauth et al.: Experimental infection of domestic dogs and cats with SARS-CoV-2: Pathogenesis, transmission, and response to reexposure in cats. PNAS, 29. September 2020, doi:10.1073/pnas.2013102117
- ↑ Fall in Belgien – Katze positiv auf Coronavirus getestet. Auf n-tv.de vom 27. März 2020.
- ↑ Coronavirus: Belgian cat infected by owner. Auf: brusselstimes.com vom 27. März 2010.
- ↑ Bericht des Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Hong Kong. Auf: oie.int, Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE), 5. Mai 2020.
- ↑ Qiang Zhang et al.: SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation. Auf: bioRxiv, Preprint vom 3. April 2020, doi:10.1101/2020.04.01.021196 .
- ↑ Coronavirus can infect cats — dogs not so much. Auf: nature.com vom 1. April 2020.
- ↑ Peter J. Halfmann et al.: Transmission of SARS-CoV-2 in Domestic Cats. In: The New England Journal of Medicine, Online-Publikation vom 13. Mai 2020, doi:10.1056/NEJMc2013400 .
- ↑ Cats Can Spread COVID-19 Coronavirus Infection to Other Cats. Auf: scitechdaily.com vom 29. März 2020, Quelle: University of Tokyo
- ↑ a b c Lars Fischer: Coronavirus: Welche Rolle spielen Haustiere bei der Pandemie? Auf: spektrum.de vom 4. Juni 2020, Quelle: Nature
- ↑ Joaquim Segalés, Mariona Puig, Jordi Rodon et al.: Detection of SARS-CoV-2 in a cat owned by a COVID-19−affected patient in Spain. In: PNAS. Online-Vorabveröffentlichung vom 18. September 2020, doi:10.1073/pnas.2010817117 .
Details Revealed About the First Cat Infected With SARS-CoV-2 Coronavirus in Spain – Including Necropsy Findings. Auf: scitechdaily.com vom 25. September 2020. - ↑ Covid-19 bei einer Katze in der Schweiz. In: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. 3. Dezember 2020, abgerufen am 4. Dezember 2020.
- ↑ Angela M. Bosco-Lauth et al.: Experimental infection of domestic dogs and cats with SARS-CoV-2: Pathogenesis, transmission, and response to reexposure in cats. In: PNAS. Band 117, Nr. 42, 2020, S. 26382–2638829, doi:10.1073/pnas.2013102117
- ↑ nature.com>Coronavirus can infect cats-dogs not so much, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-00984-8 , Abgerufen am 13. April 2021
- ↑ a b Covid-19: Die fünf großen Fragen über den Ursprung der Pandemie.
- ↑ Pelztiere erkranken massenhaft an Covid-19. Auf: sueddeutsche.de vom 14. Mai 2020.
- ↑ Nadia Oreshkova et al.: SARS-CoV2 infection in farmed mink, Netherlands, April 2020. Preprint auf bioRxiv vom 18. Mai 2020, doi:10.1101/2020.05.18.101493 .
- ↑ a b Warum eine mutierte Coronavirus-Variante Dänemark dazu veranlasst, seine gesamte Nerzpelz-Branche zu zerstören. Auf: nzz.ch vom 6. November 2020.
- ↑ Coronavirus rips through Dutch mink farms, triggering culls to prevent human infections. Auf: sciencemag.org vom 9. Juni 2020.
- ↑ International Society for Infectious Diseases: Coronavirus Disease 2019 Update (209): Netherlands (North Brabant), Farmed Mink, Animal-to-Human, Cat, Epidemiology. Bericht vom 25. Mai 2020.
- ↑ International Society for Infectious Diseases: Coronavirus Disease 2019 Update (215): Netherlands (NB), Animal, Mink-to-Human, Epidemiology, Control. Bericht vom 27. Mai 2020.
- ↑ Bas B. Oude Munnink, Reina S. Sikkema, Marion Koopmans (Leitung), David F. Nieuwenhuijse et al.: Transmission of SARS-CoV-2 on mink farms between humans and mink and back to humans. In: Science. Online-Publikation vom 10. November 2020, eabe5901, doi:10.1126/science.abe5901 .
- ↑ David Nield: COVID-19 Has Caused Over 1 Million Mink to Be Killed Due to Culling at Fur Farms, auf: sciencealert vom 14. Oktober 2020.
- ↑ Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink, ecdc.
- ↑ OIE: SARS-CoV-2/COVID-19, United States of America. Mitteilung des United States Department of Agriculture, Washington, vom 26. Juli 2020.
OIE: SARS-CoV-2/COVID-19, United States of America. Mitteilung des United States Department of Agriculture, Washington, vom 2. Oktober 2020. - ↑ Denmark to cull up to 17 million mink amid coronavirus fears. Auf: bbc.com vom 5. November 2020.
- ↑ a b Bärbel Hilbig: Impfstoff gegen mutierte Viren nutzlos? Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23. Oktober 2020, S. 1.
- ↑ Christian Stichler: Das große Schlachten auf den Nerzfarmen. Auf: tagesschau.de vom 1. November 2020.
- ↑ Millionen gekeulter Tiere: Dänemark will tote Nerze wieder ausgraben. Auf: n-tv.de vom 20. Dezember 2020.
- ↑ Briten: Einreiseverbot für Dänen – Infizierte Nerze in sechs Ländern entdeckt. Auf: n-tv.de vom 7. November 2020.
- ↑ SARS-CoV-2 bei Nerzen: Empfehlungen zur Verbesserung der Überwachung. Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, 18. Februar 2021, abgerufen am 28. Februar 2021.
- ↑ Corona-Mutation in Dänemark – WHO gibt Risiko-Einschätzung zu Nerz-Virus, auf: n-tv.de vom 6. November 2020
- ↑ Young-Il Kim et al.: Infection and Rapid Transmission of SARS-CoV-2 in Ferrets. In: Cell Host & Microbe. Online-Vorabveröffentlichung vom 6. April 2020, doi:10.1016/j.chom.2020.03.023 .
- ↑ a b Neues Coronavirus SARS-CoV-2: Flughunde und Frettchen sind empfänglich Schweine und Hühner nicht. Auf: idw-online.de vom 2. April 2020.
- ↑ Stephanie Pappas: Endangered ferrets get experimental COVID-19 vaccine. Auf: LiveScience.com vom 1. Januar 2021.
- ↑ Nach Massentötungen in Dänemark – Finnland entwickelt Corona-Impfung für Nerze, auf: n-tv vom 12. Januar 2021.
- ↑ Entscheidende Testphase läuft – Russland entwickelt Corona-Impfstoff für Tiere, auf: n-tv vom 13. Dezember 2020
- ↑ Gorilla Troop at the San Diego Zoo Safari Park Test Positive for COVID-19. Auf: zoo.sandiegozoo.org vom 11. Januar 2021.
- ↑ USDA-APHIS confirms COVID-19 in gorillas at San Diego Zoo Safari Park. Auf: federallabs.org vom 11. Januar 2021.
- ↑ Nadja Podbregar: Erste Gorillas mit dem Coronavirus infiziert – Menschenaffen im Zoo von San Diego sind an Covid-19 erkrankt. Auf: scinexx.de vom 12. Januar 2021, Quelle: San Diego Zoo Global
- ↑ NCBI: Human coronavirus OC43 (no rank)
- ↑ Nadja Podbregar: Coronavirus: Sind auch Menschenaffen gefährdet? Auf: scinexx.de vom 30. März 2020.
- ↑ Chuan Qin et al.: Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques. In: bioRxiv. 14. März 2020, bioRxiv: 10.1101/2020.03.13.990226v1 (Preprint-Volltext), doi:10.1101/2020.03.13.990226.
- ↑ Keine Mehrfachansteckung mit SARS-CoV-2 bei Affen. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Deutsches Ärzteblatt. Deutscher Ärzteverlag, 18. März 2020, archiviert vom Original am 19. März 2020; abgerufen am 19. März 2020.
- ↑ Können Menschen zweimal Covid-19 kriegen?, auf: n-tv.de vom 18. April 2019, Quelle: ntv.de, Amélie Bottollier-Depois, AFP
- ↑ Abishek Chandrashekar et al.: SARS-CoV-2 infection protects against rechallenge in rhesus macaques. In: Science, Online-Vorabveröffentlichung vom 20. Mai 2020, eabc4776, doi:10.1126/science.abc4776 .
- ↑ Barry Rockx, Thijs Kuiken, Sander Herfst et al.: Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS in a nonhuman primate model. In: Science, Online-Vorabveröffentlichung vom 17. April 2020, abb7314, doi:10.1126/science.abb7314 .
- ↑ A Tiger In New York Has tested Positive For Coronavirus. Auf: sciencealert.com vom 6. April 2020. Quelle: Agence France-Presse.
- ↑ OIE: Immediate notification: SARS-CoV-2/COVID-19, United States of America. Bronx County, Bronx, New York. Auf: oie.int vom 6. April 2020.
- ↑ SARS-COV-2/COVID-19, South Africa. Meldung des Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Animal Production and Health an die OIE, 11. August 2020.
- ↑ Jianzhong Shi et al.: Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS–coronavirus 2. In: Science, Online-Vorabveröffentlichung vom 8. April 2020, eabb7015, doi:10.1126/science.abb7015 .
- ↑ Jon Cohen: From mice to monkeys, animals studied for coronavirus answers. In: Science, Band 368, Nr. 6488, 2020, S. 221 f, doi:10.1126/science.368.6488.221 , Volltext
- ↑ Kore Schlottau, Melanie Rissmann, Annika Graaf, Jacob Schön, Julia Sehl, Claudia Wylezich, Martin Beer et al.: SARS-CoV-2 in fruit bats, ferrets, pigs, and chickens: an experimental transmission study. In: The Lancet, 7. Jul 2020, doi:https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30089-6 , PDF
- ↑ https://www.agrarheute.com/tier/rind/corona-studie-empfaenglich-rinder-572258 Corona-Studie: Wie empfänglich sind Rinder?
- ↑ Shi-Hui Sun, You-Chun Wang et al.: A Mouse Model of SARS-CoV-2 Infection and Pathogenesis, in: Cell Host and Microbe vom 26. Mai 2020, doi:10.1016/j.chom.2020.05.020
- ↑ Jacinta Bowler: Scientists Find a Way to Infect Mice With Coronavirus. Here's Why That's So Important, auf: sciencealert vom 1. Juni 2020
- ↑ Andrea J. Pruijssers, Amelia S. George, Alexandra Schäfer, Sarah R. Leist, Lisa E. Gralinksi: Remdesivir Inhibits SARS-CoV-2 in Human Lung Cells and Chimeric SARS-CoV Expressing the SARS-CoV-2 RNA Polymerase in Mice. In: Cell Reports. Band 32, Nr. 3, Juli 2020, S. 107940, doi:10.1016/j.celrep.2020.107940, PMID 32668216, PMC 7340027 (freier Volltext).
- ↑ Tina Hesman Saey: Remdesivir may work even better against COVID-19 than we thought, auf: ScienceNews vom 13. Juli 2020
- ↑ Informationen der BAuA: Neuartiges Virus SARS-CoV-2 (bislang 2019-nCoV) durch den ABAS in Risikogruppe 3 eingestuft und Empfehlungen zur Labordiagnostik gegeben. In: Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 19. Februar 2020, abgerufen am 23. Februar 2020.
- ↑ a b Beschluss 1/2020 des ABAS vom 19. 2. 2020 und Begründung zur vorläufigen Einstufung des Virus SARS-CoV-2 in Risikogruppe 3 und Empfehlungen zu nicht gezielten Tätigkeiten (Labordiagnostik) und gezielten Tätigkeiten mit SARS-CoV-2. (PDF; 140 kB) In: Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 19. Februar 2020, abgerufen am 23. Februar 2020.
- ↑ Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: Website der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 16. Februar 2020, abgerufen am 23. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Paul-Ehrlich-Institut: COVID-19-Tests: NAT-Test gilt als Goldstandard, zu NAT-Tests gehört auch die PCR-Methode. Stand 23. März 2020, abgerufen am 25. August 2020.
- ↑ https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/infektionskrankheiten/coronavirus/corona-nachweis-die-testverfahren-im-ueberblick-724147.html
- ↑ Jon Cohen: Scientists are moving at record speed to create new coronavirus vaccines—but they may come too late. In: Science. 27. Januar 2020, doi:10.1126/science.abb0612 (englisch).
- ↑ Finn Mayer-Kuckuk: Suche nach Corona-Impfstoff: Das heiße Rennen. In: Die Tageszeitung: taz. 17. März 2020, ISSN 0931-9085 (taz.de [abgerufen am 18. März 2020]).
- ↑ Lars Fischer, Alina Schadwinkel: Verursacht das Coronavirus Engpässe bei Medikamenten? Stammt das Virus aus dem Pangolin? Website Spektrum.de, 10. Februar 2020, abgerufen am 15. Februar 2020.
- ↑ Sechste Infektion bestätigt: Kind in Bayern an Coronavirus erkrankt. In: Website tagesschau.de. 31. Januar 2020, abgerufen am 9. Februar 2020.
- ↑ Donald Trumps Test auf Coronavirus negativ ausgefallen. In: Der Spiegel – Politik. Abgerufen am 15. März 2020.
- ↑ WHO: Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines. (PDF) (PDF). In: Website der World Health Organization (WHO). WHO, 2. Dezember 2020, abgerufen am 3. Dezember 2020 (englisch, Spezifikationen und Links zu weiteren Infos über alle von der WHO aufgelisteten Impfstoffkandidaten).
- ↑ Impfstoffe gegen Coronavirus – aktueller Entwicklungsstand | vfa. Abgerufen am 30. März 2021.
- ↑ https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/123692RKI-Chef-Wieler-gegen-schnelle-Lockerungen-der-Coronamassnahmen, abgerufen am 9. Mai 2021.
- ↑ Wie soll der Zugang zu einem COVID-19-Impfstoff geregelt werden?, Positionspapier der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut, des Deutschen Ethikrates und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 9. November 2020. Abgerufen am 9. November 2020.
- ↑ Coronavirus vaccine developers wary of errant antibodies www.nature.com, 5. Juni 2020
- ↑ Pathogenesis of oral type I feline infectious peritonitis virus (FIPV) infection: Antibody-dependent enhancement infection of cats with type I FIPV via the oral route www.ncbi.nlm.nih.gov, Online-Veröffentlichung 23. April 2019
- ↑ www.rki.de: Lieferengpässe.
- ↑ Gesundheitssenatorin begrüßt Ausweitung des Risikogebiets durch Robert-Koch-Institut. In: berlin.de. 26. Februar 2020, abgerufen am 29. Februar 2020.
- ↑ Coronavirus: Wann gilt der Katastrophenfall – und was folgt? In: rbb24.de. 26. Februar 2020, abgerufen am 29. Februar 2020.
- ↑ Weltgesundheitsorganisation: Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). 30. Januar 2020, abgerufen am 30. Januar 2020 (englisch).
- ↑ Tedros Adhanom Ghebreyesus: WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. In: Website WHO. 11. März 2020, abgerufen am 12. März 2020 (englisch).
- ↑ Amtliche Begründung im Gesetzentwurf auf BT-Drs. 19/18967, S. 55.
- ↑ Schutzpaket für mehr Coronatests und Pflege-Prämien beschlossen. Deutscher Bundestag, 14. Mai 2020, abgerufen am 14. Mai 2020.
- ↑ Nichtnamentliche Meldepflicht von Untersuchungsergebnissen. Robert Koch-Institut, 4. Juni 2020, abgerufen am 8. Juni 2020.
- ↑ Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020, BGBl. 2020 I S. 2397.
- ↑ Meldepflicht bei Corona-Infektionen von Haustieren. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2. Juli 2020, abgerufen am 1. November 2020.
- ↑ Epidemiegesetz 1950. Bundesrecht konsolidiert, Gesamte Rechtsvorschrift. In: RIS. 14. Juni 2018, abgerufen am 6. März 2020: „Der Anzeigepflicht unterliegen: […] (2) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann, […], durch Verordnung weitere übertragbare Krankheiten der Meldepflicht unterwerfen oder bestehende Meldepflichten erweitern.“
- ↑ 15. Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020. In: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 26. Januar 2020, abgerufen am 4. März 2020: „Der Anzeigepflicht nach dem Epidemiegesetz1950 unterliegen Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle an 2019-nCoV („2019 neuartiges Coronavirus“).“
- ↑ Absonderungsverordnung. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Absonderung Kranker, Krankheitsverdächtiger und Ansteckungsverdächtiger und Bezeichnung von Häusern und Wohnungen, Fassung vom 06.03.2020. In: RIS, Bundesrecht konsolidiert. 31. Januar 2020, abgerufen am 6. März 2020: „Bei Masern oder Infektion mit 2019-nCoV (“2019 neuartiges Coronavirus„) sind die Kranken und Krankheitsverdächtigen abzusondern oder nach den Umständen des Falles lediglich bestimmten Verkehrsbeschränkungen zu unterwerfen.“
- ↑ Verordnung vom 31. Jänner 2020. 21. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der die Verordnung des Ministers des Innern im Einvernehmen mit dem Minister für Kultus und Unterricht vom 22. Februar 1915, betreffend die Absonderung Kranker, Krankheitsverdächtiger und Ansteckungsverdächtiger und die Bezeichnung von Häusern und Wohnungen geändert wird. In: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 31. Januar 2020, abgerufen am 6. März 2020: „In § 4 3. Satz wird nach dem Wort „Masern“ die Wortfolge „oder Infektion mit 2019-nCoV (“2019 neuartiges Coronavirus„)“ eingefügt.“
- ↑ Neues Coronavirus: Informationen für Gesundheitsfachpersonen. Verdachts- und Meldekriterien sowie Meldeformular. Bundesamt für Gesundheit, 5. März 2020, abgerufen am 5. März 2020.
- ↑ Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen. Epidemiengesetz, EpG. Bundeskanzlei, 1. Januar 2017, abgerufen am 6. März 2020.
- ↑ Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen. (Epidemienverordnung, EpV) vom 29. April 2015 (Stand am 1. März 2019). Bundeskanzlei, abgerufen am 6. März 2020.
- ↑ Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen. vom 1. Dezember 2015 (Stand am 1. Februar 2020). Bundeskanzlei, abgerufen am 6. März 2020.
- ↑ Meldeformulare. COVID-19 Meldung. Bundesamt für Gesundheit, 18. Mai 2020, abgerufen am 8. Juni 2020.
Information
Der Artikel SARS-CoV-2 in der deutschen Wikipedia belegte im lokalen Ranking der Popularität folgende Plätze:
- 10. Platz im 2020-03-01
- 6. Platz im 2020-03-02
- 6. Platz im 2020-03-03
- 15. Platz im 2020-03-04
- 7. Platz im 2020-03-05
- 16. Platz im 2020-03-06
- 8. Platz im 2020-03-07
- 12. Platz im 2020-03-08
- 15. Platz im 2020-03-09
- 14. Platz im 2020-03-10
- 8. Platz im 2020-03-11
- 7. Platz im 2020-03-12
- 5. Platz im 2020-03-13
- 9. Platz im 2020-03-14
- 8. Platz im 2020-03-15
- 10. Platz im 2020-03-16
- 10. Platz im 2020-03-17
- 10. Platz im 2020-03-18
- 8. Platz im 2020-03-19
- 10. Platz im 2020-03-20
- 9. Platz im 2020-03-21
- 13. Platz im 2020-03-22
- 13. Platz im 2020-03-23
- 19. Platz im 2020-03-24
- 12. Platz im 2020-03-25
- 8. Platz im 2020-03-26
- 14. Platz im 2020-03-27
- 11. Platz im 2020-03-28
- 25. Platz im 2020-03-29
- 15. Platz im 2020-03-30
- 16. Platz im 2020-03-31
Über die Seite
Der präsentierte Inhalt des Wikipedia-Artikels wurde im 2021-06-12 basierend auf extrahiert https://de.wikipedia.org/?curid=11114268